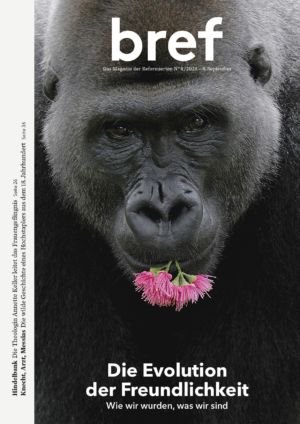Am 3. Mai 1792, nach dem Mittagessen, setzt sich Anton Unternährer in seiner Stube hin. Dann hört er eine Stimme, die ihm sagt, er solle sich aufs Bett legen. Ein helles Licht erscheint, und Anton sieht Christus. Der teilt ihm mit, dass er, der einfache Knecht und Kuhhirte, der kurz davor ist, Vater zu werden, der Auserkorene sei. Der Menschensohn, durch den Jesus Christus dereinst über die Welt richten werde.
So wird es Anton «Mettlentoneli» Unternährer viele Jahre später im Gefängnis aufschreiben. Auch Beweise für seine Berufung wird er präsentieren: In Anton sei das A und O enthalten, also der Anfang und das Ende, wie Christus in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Und Unternährer bedeute den untersten, geringsten der Menschen, also Christus.
Luzern bedeute so viel wie Leuchte, und Gott ist das Licht, also sei klar, dass der wiederauferstandene Christus ein Luzerner sein müsse.
Das Dorf Schüpfheim im Entlebuch, wo er aufgewachsen ist, komme vom Wort «schüpfen», was so viel bedeute wie «verworfen werden». Und in der Bibel heisst es doch: «Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.» Das Gebirge Entlebuch wiederum sei nichts anderes als das Buch des Lebens. Luzern schliesslich bedeute so viel wie Leuchte, und Gott ist das Licht, also sei klar, dass der wiederauferstandene Christus ein Luzerner sein müsse.
23 Bücher schreibt Anton während seines Lebens, mehr als 1000 Seiten voll mit abenteuerlichen Bibeldeutungen, geschrieben in schwülstiger Sprache, unterteilt in Kapitel mit Überschriften wie «Die erste / zweite / dritte Blume». Hunderte Anhänger halten ihn für den Messias – noch über ein Jahrhundert nach seinem Tod.
Archivare werden die in feinen Umschlägen gedruckten Schriften bis heute sorgfältig aufbewahren. Und zahlreiche Kirchenhistoriker, Sektenforscher und Psychiater werden sich mit der Frage beschäftigen: Wie kommt es, dass ein Mann aus ärmlichen Verhältnissen, der 30 Jahre lang unauffällig im luzernischen Hinterland gelebt hat, zum Gründer einer der archaischsten Sekten wird, die es in der Schweiz je gegeben hat?
Schüpfheim, 1759
Anfang September 1759 wird Anton Unternährer geboren, davon zeugt das Taufbuch von Schüpfheim. Seine Eltern sind arm, haben acht Kinder. Anton ist das zweitjüngste.
Die Familie hat den Hof Mettlen oberhalb von Schüpfheim gepachtet. Von dort kommt auch Antons Übername «Mettlentoneli». Der Hof gehört seinem Taufpaten Josef Renggli. Anton hilft auf dem Hof, wird katholisch erzogen, besucht den Religionsunterricht beim Dorfpfarrer. Mit zwölf Jahren geht er zu seinem Taufpaten Renggli, wo er als Knecht arbeitet. Die Sommerzeit verbringt er als Kuhhirte auf der Alp. Sein Leumund ist tadellos: Er sei ein guter Arbeiter und falle mit wohlgefälligem Betragen auf, heisst es im Dorf.
Sein Glück ist, dass Renggli, ein wohlhabender und angesehener Mann, ihn offensichtlich mag. Er fördert ihn, lehrt ihn nicht nur das Schreinern, sondern auch das Lesen und Schreiben – Schule ist damals, mit Ausnahme des Religionsunterrichts, Privatsache. Anton nimmt, so heisst es, in seiner freien Zeit häufig die Bücher zur Hand, die in Rengglis Haus herumstehen. Darunter viele Werke, die sich mit magischen Künsten beschäftigen, oder Aberglauben, das ist Ansichtssache. Er schaut Rengglis Frau zu, wie sie nach Anleitung aus Büchern Schwindhölzchen fertigt, die als Heilmittel dienen. Auch «magische» Alpenkräuter sammelt Anton zu dieser Zeit.
Paris, 1786
In Frankreich weht der Wind der Aufklärung. Montesquieu hat die Gewaltenteilung gefordert, Rousseau das Privateigentum als Ursache für soziale Ungleichheit identifiziert und Diderot eine Art Aufklärungslexikon verfasst. Vor allem aber ist die Finanzlage des Ancien Régime desaströs, der Brotpreis steigt, den Menschen geht es schlecht. Drei Jahre später wird die Französische Revolution ganz Europa umkrempeln, Demokratie und Menschenrechte neu erfinden.
Solches kann Anton höchstens ahnen, als er durch die Gassen von Paris spaziert, wo Aufstände wegen der Hungersnot an der Tagesordnung sind. Über einen Zwischenhalt im Baselbiet, wo er einige Monate lang als Knecht gearbeitet hat, ist er in die französische Hauptstadt gekommen. Anton will Maler werden. Wie er sich die Reise finanziert, ob sein Förderer Renggli dahintersteckt, darüber ist nichts bekannt.
Anton sucht in den Gassen der französischen Hauptstadt nach einem Onkel aus dem Entlebuch, der sich angeblich in Paris niedergelassen hat. Von ihm will er das Malen lernen. Doch es stellt sich heraus: Der Onkel ist bereits tot. Statt Malen lernt Anton das Fabrizieren von Barometern und Thermometern, immerhin.
Weil er das Meer sehen will, reist er weiter nach Calais. Dann kehrt er, nach einem Jahr auf Reisen, ins Entlebuch zurück. Wenig später heiratet er, wird Vater, und während in Paris die Revolution in vollem Gang ist, der König flieht, gefangen und eingesperrt wird, die Kirchen geschlossen, die Religion zum Aberglauben erklärt wird, gerät auch in Antons Leben alles aus den Fugen.
Schüpfheim, 1792
Anton hält seine erste eigene Bibel in der Hand. Ein alter, für künftige Historiker rätselhafter Mann namens «Johannes» hat sie ihm geschenkt. Der ist nun öfter zu Besuch.
Anton lebt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in einem einsamen Häuschen ausserhalb von Schüpfheim. Die beiden Söhne, die im Alter von sechs Monaten und eineinhalb Jahren gestorben sind, wird er in den über 1000 Seiten, die er noch über sein Leben als zweiter Christus schreiben wird, nie erwähnen. Er ist nun nicht mehr Knecht, sondern Familienoberhaupt. Entsprechend sucht er eine Arbeit, die dieser neuen Rolle gebührt. Ein Jahr lang arbeitet er als Schreiner, dann fertigt er Barometer. Auch als Lehrer versucht er sich, zieht sich aber zurück, weil ein anderer Privatlehrer im Dorf beliebter ist.
Der Mann namens Johannes bringt nicht nur die Bibel mit, sondern auch einige medizinische und chirurgische Bücher. Die beiden reden offenbar, so werden es Zeugen später der Polizei in Einvernahmen berichten, häufig bis in die späte Nacht hinein, über Religion, heilende Pflanzen und Traumathurgie – oder anders gesagt: über Wunder.
Die will Anton nun vollbringen. Es ist das Jahr, als er erstmals die Stimme hört, die ihn zum Auserwählten bestimmt. Einmal hört er auch: «Du bist ein Hirtenknabe gewesen lange Jahre; jetzt will ich verschaffen, dass du ein Arzt wirst und musst in Berg und Tal reisen und bei den Armen und Gläubigen Wunderkuren tun.»
Mehrfach besucht Anton den Dorfarzt im bernischen Schwarzenegg, erlernt von ihm medizinisches und chirurgisches Handwerk, wie seine Frau später in Verhören zu Protokoll geben wird. Dann nennt er sich Arzt und tourt durch die Gegend. Seine Kundschaft soll vor allem aus «ratsuchenden Weibern» bestehen, heisst es im Dorf.
Bern, 1798
Die Revolution kommt in die Schweiz. Im katholischen Luzern dankt die aristokratische Regierung ab und legt die Gewalt – nach der Forderung der französischen Revolutionäre – in die Hände des Volkes. In Bern ziehen im März französische Truppen ein. Die Alte Eidgenossenschaft, ein seit dem Mittelalter bewährter loser Staatenbund, ist Geschichte.
Stattdessen heisst das besetzte Land nun Helvetische Republik. Die Franzosen sind wegen zahlreichen Kriegen an allen Fronten auf Soldaten angewiesen, deswegen verlangen sie von der helvetischen Regierung Truppen. Gegen solche Rekrutierungen wehren sich zahlreiche Eidgenossen. Auch im Berner Oberland kommt es zu Aufständen. Mittendrin: Anton Unternährer.
Auf seinen Reisen als Wunderdoktor und Hausierer verbreitet Anton seine religiösen Ansichten.
Erstmals taucht sein Name deswegen in Gerichtsakten auf. Gemäss diesen versucht er die rekrutierten Soldaten am Auszug zu hindern. Und er streut Gerüchte über eine anstehende Revolution, die der von Frankreich kontrollierten Regierung nicht gefallen: «Die Urbewegung der Schweiz wird bald folgen.» Dafür muss Anton erstmals ins Gefängnis. Das helvetische Kriegsgericht verurteilt ihn zu zehn Wochen Haft.
Wieder frei, kehrt Anton dem katholischen Luzern den Rücken und zieht ins protestantische Bern. 1800 lässt er sich in einem Bauernhaus in Amsoldingen nieder. Erst besucht er pietistische Veranstaltungen, dann organisiert er eigene Versammlungen bei sich zuhause. Auf seinen Reisen als Wunderdoktor und Hausierer rund um die Dörfer Amsoldingen, Schwarzenburg und Seftigen bei Thun verbreitet er seine religiösen Ansichten. Innerhalb von zwei Jahren gewinnt er 70 Anhänger.
Bern, 1802
Womöglich beflügelt vom Erfolg, schreibt Anton ein Buch, 92 Seiten, in denen er mit den Reichen und Mächtigen abrechnet. Regierungsleute, Pfarrer, Richter und Lehrer, sie alle seien «Kinder des Teufels, Hurer, Ehebrecher sowie Götzendiener» und würden dereinst vom Feuer Gottes verzehrt und von Anton persönlich «abgetan» werden. Zimperlichkeiten sind Antons Sache nicht. «Ihr verfluchtes Schlangen- und Otterngezücht, wie wollet ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?», schreibt er. 5000 Exemplare lässt er in der Nationaldruckerei in Bern herstellen.
Einige Wochen später will er Fakten schaffen. In einer nächtlichen Versammlung bei sich zuhause im Dörfchen Amsoldingen bei Thun kündigt Anton das Jüngste Gericht an. Er fordert seine Anhänger auf, am Karfreitag nach Bern zu kommen. Es werde «etwas Grosses» passieren bei der Münsterkirche. Weil er sich seiner Sache offenkundig sicher ist, schickt er auch den obersten (weltlichen) Richtern Berns eine Einladung.
Als es so weit ist, reisen ein paar Dutzend «Antonianer» in die Stadt. So nennt das Volk Antons Anhänger. Gerüchte kursieren unter den Anwesenden. Manche glauben, dass Anton in der reformierten Kirche predigen wird. Die andern sind sich sicher, das Münster werde einstürzen. Wieder andere vermuten, Anton werde in feurigem Wagen zum Himmel fahren.
Stattdessen kommt die Polizei und nimmt den ganzen Schwarm fest.
Im Verhör antwortet Anton auf die Frage, was denn an diesem Tag Grosses hätte geschehen sollen: «Es ist ja etwas passiert. Ihr habt uns alle verhaftet.»
Die Richter sind sich sicher, dass Anton erstens verrückt und zweitens gefährlich ist. Sie stecken ihn für zwei Jahre ins Zuchthaus.
Amsoldingen, 1805
In Haft schreibt Anton seine Erleuchtungen auf. Seine Frau und seine Anhänger schmuggeln die Schriften hinaus. Vermutlich erzählt er auch seinen Mitinsassen von seinen Visionen. Überliefert ist lediglich, dass er eine zerquetschte rechte Schulter und zwei gebrochene Rippen aus der Zeit im Gefängnis davonträgt. Später wird er seinen Anhängern sagen, sein lahmer Arm komme vom Tragen des Kreuzes.
Schliesslich kommt Anton frei und kehrt nach Amsoldingen zurück. Doch er hat ein Problem: Er ist pleite. Die Richter haben nicht nur die verbliebenen Exemplare von Antons Buch konfiszieren, sondern auch seine Wertsachen versteigern lassen. In diesem Inventar finden sich drei grosse Kräuterbücher, sieben Bände Magie und Zauberbücher, ein medizinisches Handlexikon, 182 Stück andere medizinische und chirurgische Bücher sowie medizinische Geräte wie Spritzen, Messer und drei Gebärzangen.
Kurz darauf kommt ein weiteres Problem hinzu: Gerüchte von wilden nächtlichen Orgien in Antons Haus mit «Weibertausch» machen die Runde. Behördenvertreter notieren besorgt: «In den eigentlichen Versammlungen wurden dann bald die Lichter ausgelöscht und als dann sehr wahrscheinlich dem Lehrsatz der Gemeinschaft der Weiber gehuldiget.»
33 Einwohner protestieren per Brief: Man solle Anton aus dem Lande entfernen, «für Ruhe und die leibliche und geistige Wohlfahrt der Gemeinde». Viktor Von Wattenwyl, Oberamtmann von Thun, schlägt vor, Anton mit 25 Prügeln zu züchtigen. Doch in Bern begnügt man sich damit, ihn festzunehmen und «auf ewig» ins katholische Luzern abzuschieben. Dort landet er erneut im Gefängnis.
Luzern, 1806
Anton wird von Thaddäus Müller aus seiner Zelle geholt. Müller ist Stadtpfarrer und Leutpriester und damit beauftragt worden, ein Gutachten über Anton zu schreiben.
Noch vor kurzer Zeit machte man in Luzern kurzen Prozess mit Leuten wie Anton: Jakob «Sulzig-Joggi» Schmidlin wurde 1747 für das Organisieren pietistischer Versammlungen gefoltert, erwürgt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Doch die Zeiten haben sich geändert.
«Habet euch unter einander inbrünstig lieb aus reinem Herzen und gebet eure Leiber zum Opfer.» Aus Antons Schriften
Ist Anton verrückt? Oder gefährlich? Weder noch, schreibt Müller, ein frommer Katholik, in seinem Bericht. Anton zeige in seinem Betragen Anstand, Bescheidenheit und Unterwerfung. Anton sei «fern von rohem oder trotzigem Benehmen». Überhaupt scheinen sich die beiden ganz gut zu verstehen. «Auch jenes finstere Wesen, wodurch sonst Religionsschwärmer sich auszeichnen, hat er nicht an sich, sondern ist heiter, freundlich und beredt.»
Es lasse sich nicht die geringste Spur von einer Verirrung des Verstandes wahrnehmen. «Eine harte Bestrafung, wie z. B. eines Übeltäters, verdient er nicht», schreibt Müller.
Darauf lässt Luzern den «verirrten Schwärmer» laufen. Da er sich aber allem Anschein nach nicht an den verordneten Hausarrest hält und weiter Besuch von seinen Berner Anhängern erhält, muss er zurück ins Zuchthaus.
Schüpfheim, 1811
Fünf Jahre verbringt Anton hinter Gittern, dann wird das Ganze den Luzernern zu teuer. Sie schicken ihn zurück nach Schüpfheim, wo ihn der Ortspfarrer zusammen mit der Verwaltung beaufsichtigen soll.
Anton lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in einem abgelegenen Haus weit ausserhalb von Schüpfheim. Hin und wieder besuchen ihn seine Anhänger. Er hat nun Zeit, seine Brachial-Theologie weiterzuentwickeln. Diese besteht im Grunde aus nur zwei Elementen: Erstens, Anton ist der Messias, wer das nicht glaubt, kommt in die Hölle. Ein Grossteil der Eidgenossenschaft befinde sich bereits darin, schreibt Anton, das ergebe sich nur schon aus ihrem Namen: «Höll-vetia».
Zweitens, es gibt nur ein wahres Gebot Gottes, und zwar jenes der Liebe: «Seid fruchtbar und mehret euch.» Entsprechend gibt es nur ein Gott wohlgefälliges Sakrament, nur eine einzige Art des wahren Gottesdienstes: den Geschlechtsverkehr. «Habet euch unter einander inbrünstig lieb aus reinem Herzen und gebet eure Leiber zum Opfer», schreibt er.
Im Grunde ist also alles schnell gesagt. Doch Anton schreibt Hunderte von Seiten, feilt an den Details. Sehr anschaulich beschreibt er das Paradies beziehungsweise das «neue Jerusalem». Diese «Stadt der Seligen» liegt auf einem Berg, hat die Form eines riesigen Würfels sowie 12 000 Stockwerke. Umgeben ist sie von 24 000 Palästen. In der Stadt stehen überall herrliche Lustgärten mit goldenen Stühlen und Tischen. Je ein Bräutigam und eine Braut sitzen daran und essen eine Engelsspeise, nackt und ohne Scham. Der ganze Palast ist durchsichtig, und inmitten der Stadt steht der Baum des Lebens, der in alles hineinreicht. Und dieser Baum des Lebens, das ist Christus und damit Anton selbst.
Alles in allem eine schöne Voyeursphantasie. Und eine, die nicht nur Anton gefällt. Noch viele Jahre nach seinem Tod tauchen Antons Worte in Gerichtsakten auf. Junge Mädchen, die wegen Schwangerschaft vor die Sittengerichte kamen, heisst es da, verteidigten sich frischweg mit dem Argument, sie hätten mit dem oder jenem Abendmahl gefeiert oder mit ihm vom Baum des Lebens genossen.
Luzern, 1820
Den Bernern wird das Treiben von Antons Anhängern zu bunt, denn diese befinden sich fast ausschliesslich auf ihrem Gebiet. Sie bitten die Luzerner, den gefährlichen Mann wieder ins Zuchthaus zu stecken.
Darauf wird Anton, inzwischen 61jährig und für damalige Zeit ein alter Mann, festgenommen. Als er fürs Verhör den Gerichtssaal betritt, geht er eilig auf seinen Stuhl zu, hebt ihn auf, kehrt damit zur Türe zurück und legt ihn, die Stuhlbeine nach oben, neben den Ofen an die Wand. Mit erhobenem Kopf und starrem Blick kehrt er dann zum Eingang zurück und spricht in laut gebieterischem Ton: «Ich stehe nun vor Gott im Geist und nimmer vor Euch, ich habe dem weltlichen Richter nicht mehr zu antworten.» Er habe es nun schon mehrfach gesagt: «Ihr habt mich schon lange ungerecht im Gefängnis gehabt, aber nun ist Euch das Gericht angekündigt.» Wenn er bis abends sechs Uhr nicht frei werde, so werde Unglück und Verdammnis über die Regierung kommen.
Im Laufe der Verhandlung kündigt Anton erneut den Weltuntergang an.
Davon lassen sich die Polizisten aber wenig beeindrucken. So notieren die Protokollanten, dass sich Anton nach «ernstlicher Zurechtweisung», was auch immer das heisst, ergeben hinsetzt und die Fragen ohne weitere Umstände beantwortet.
Im Laufe der Verhandlung kündigt Anton erneut den Weltuntergang an. Und zwar auf den 8. August 1822, im Jahr 20 in der Zeitrechnung der Antonianer, die mit der Ankündigung des Jüngsten Gerichts vor dem Berner Münster begonnen hat. Er werde als Herr, der auf dem Stuhle sitze, die Macht haben, das Buch mit den sieben Siegeln aufzutun – eine biblische Vision für das Ende der Welt. Er werde die Macht der Richter aufheben und die Ungläubigen innerhalb von sechs Wochen allesamt vernichten. Die Menschen würden vor Angst und Schrecken halb oder ganz nackt herumgetrieben werden. Er aber und seine Nachfolger würden gleich darauf «verjüngt und in Hülle und Fülle in unaussprechlicher Seligkeit» die Erde bevölkern.
Statt der Apokalypse löst Anton eine Mini-Psychose unter seinen Unterstützern aus. Viele seiner Anhänger verbrauchen oder verschenken ihr ganzes Hab und Gut. Das war’s dann aber auch. Zwei Jahre später trifft in Bern eine einzeilige Mitteilung aus Luzern ein: Anton Unternährer sei am 29. Juni im Rosengartenturm «mit Tod abgegangen».
Luzern, 1929
Über 100 Jahre sind seit Antons Tod vergangen, doch seine archaischen Lehren sind nicht totzukriegen. In der «Friedensburg» auf dem Stollberg in Littau bei Luzern halten Antonianer Versammlungen ab, in denen «dem Treiben zwischen den beiden Geschlechten spezielle Aufmerksamkeit geschenkt wird», wie die Kantonspolizei Luzern 1929 rapportiert und daraufhin einer gewissen Rosa F. aus sittlichen Gründen das Sorgerecht über ihr Kind entzieht.
Nun, mit etwas Abstand, beugen sich auch zahlreiche Historiker, Sektenforscher und Psychologen über den Fall. Sie fragen sich: Was hat den Mann geritten? Und: Wie kann es sein, dass ein armer Hirte, der abenteuerliche, ja grössenwahnsinnige Ideen spinnt, in die Schweizer Geschichte eingeht?
Am vielleicht überzeugendsten deutet der Mythenforscher Sergius Golowin das Leben Antons: Das Land sei während der stürmischen Revolutionszeit voll gewesen mit Sonderlingen wie Anton. Sekten wiederum seien insbesondere auf dem Land so beliebt gewesen, weil das Volk hier «in seiner Sehnsucht nach einem freien Lebensstil Bejahung fand». So gesehen wäre Anton ein gewiss archaischer Reformtheologe, der seinen kleinen Teil dazu beigetragen hat, den Staat und damit auch die Kirchen zu reformieren. 1848, 28 Jahre nach Antons Tod, wurde die moderne Eidgenossenschaft gegründet.
Vielleicht aber war Anton schlicht psychisch krank. Zu diesem Schluss kam der Anfang des 20. Jahrhunderts bekannte Psychologe Hermann Rorschach, als er ein Buch mit einer Persönlichkeitsanalyse über Anton schrieb. Der «Mettlentoneli» sei schizophren gewesen und habe ein Leben lang unter einem heftigen Minderwertigkeitskomplex gelitten. Den habe er mit einer «Sozialisierung seiner Libido» überkompensieren wollen. Dazu passt, dass Anton, um seine Göttlichkeit zu demonstrieren, offenbar öfter einmal seine Unterhose auszog. Denn er hatte, und es ist die einzige Beschreibung, die sich über Antons Äusseres weit und breit finden lässt, drei Hoden.
Warum genau dies nun Skeptiker von Antons Lehre überzeugt haben soll, ist nur ansatzweise bekannt. Der «Mettlentoneli» dürfte argumentativ mit der christlichen Dreieinigkeit jongliert und mit dem Doppelsinn des Wortes «testis» gespielt haben. So zumindest setzt Rorschach seine Beweisführung fort. Das lateinische Wort bedeute nämlich einerseits das männliche Geschlechtsorgan, andererseits aber auch «Zeugen». Von dort sei es für Anton nicht weit gewesen zur nächsten Bibelstelle: «Und drei sind es, die Zeugnis geben auf Erden: der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind eins», 1. Brief Johannes.
Unter Umständen ist es also völlig sinnlos, das Leben Antons höher zu deuten. Dann nämlich, wenn dieser in erster Linie eigene Ziele verfolgt hat. Dafür spricht sein sozialer Aufstieg, der dem eines Hochstaplers gleicht: Hirte – Maler – Schreiner – Barometermacher – Lehrer – Arzt – Prediger – Richter der Menschheit. Sowie die Tatsache, dass seine Theologie der Sex-Gottesdienste für manche Antonianer – und ihn selbst – durchaus angenehme Seiten gehabt haben dürfte.
Hinweis zur Recherche: Sämtliche Fakten dieses Artikels sind historisch belegt. Als Quellen dienten Bücher über Anton, behördliche Akten wie Briefwechsel, Gerichtsdokumente oder Polizeirapporte sowie die Schriften des Sektenführers selbst.