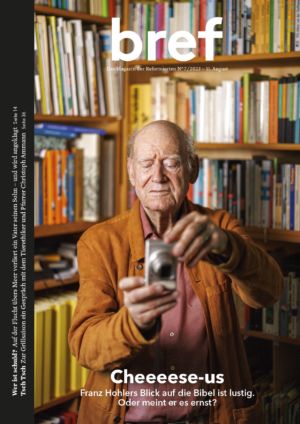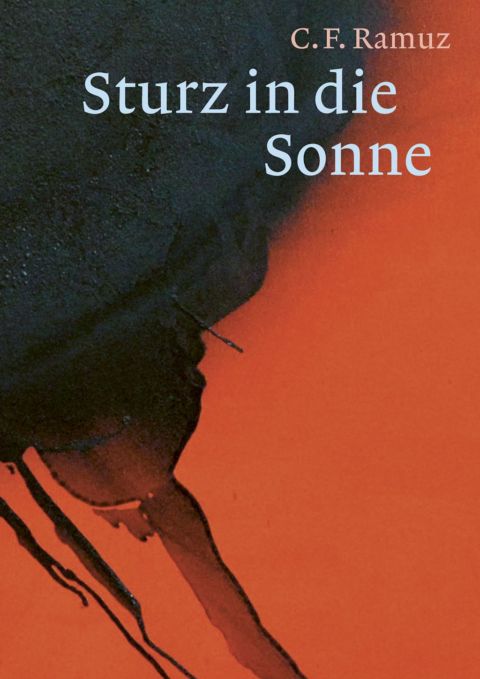
«Sturz in die Sonne» von Charles Ferdinand Ramuz
Haben Sie es gelesen?» – «Nein. Was geht mich das an?» Die Menschen wollen es nicht wahrhaben, machen so lange weiter mit dem Gewohnten, bis sie es irgendwann trotzdem wahrhaben müssen, selbst wenn es dann zu spät ist. Jeden Tag ein Grad wärmer soll es werden; schuld ist nicht der Klimawandel, sondern ein «Unfall im Gravitationssystem», der die Erde «zurück» in die Sonne stürzen lässt. Ob es Wochen, Monate oder Jahre dauern wird – welchen Unterschied macht das schon?
Natürlich glauben die Leute den Zeitungen kein Wort, was soll man mit dieser Nachricht schon anfangen: «Alles Leben wird enden.» Die Nachbarin, die die Zeitung dann doch noch gelesen hat, glaubt noch: «Die lügen hemmungslos …» Andere setzen sich schon mit dem Tod auseinander, der jetzt immerhin «alle zusammen» ereilen wird, um dann mit Schrecken zu bemerken, dass man am Ende doch immer allein ist.
Der in Lausanne geborene, ab 1904 in Paris lebende Charles Ferdinand Ramuz schrieb «Présence de la mort» («Gegenwart des Todes») unter dem Eindruck des Hitzesommers 1921, als in Genf eine Rekordtemperatur von 38,3 Grad gemessen wurde. Dass der Text zur Zeit seiner Entstehung sein Publikum eher irritierte und sich folglich schlecht verkaufte, wird nicht nur an der eigenwilligen Sprache und der zerstückelten, tableauartigen Struktur gelegen haben. Sondern vor allem daran, dass der Roman seiner Zeit in so ziemlich allen Belangen voraus war.
Übersetzer Steven Wyss betont im Nachwort dann auch seine «erschreckende Aktualität» und dass man kaum umhin komme, ihn als «prophetischen Klimaroman» zu lesen. Jedenfalls weiss man heute nicht, ob man mehr über seine Sprache oder über seine Hellsichtigkeit staunen soll.
Auf beinahe jeder Seite des relativ kurzen Textes stösst man auf Sätze, Szenen und menschliche Verhaltensweisen, die man aus jener sich langsam abspielenden Katastrophe kennt, die unsere Gegenwart ist. Auch wenn der «Unfall» in Realität nicht im Gravitationssystem, sondern in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung begründet ist, sind die Reaktionen beinahe identisch. Ramuz zeichnet sie mit der grausamen Objektivität eines Insektenforschers auf. Die Leute beginnen erst an den Ernst der Sache zu glauben, als die Seen austrocknen, die Ernten ausbleiben und die Temperatur unerträglich wird.
Bald schlägt der Hedonismus um in Gewalt und jeder schaut nur noch für sich. Dazwischen steht die Erzählstimme, die ungebunden zwischen dem Grössten und dem Kleinsten herumtanzt, einmal als alter Mann, der sich auf seinen kommenden Tod besinnt, dann wieder als abstrakter Sprecher, der sich zum Abschied an die ganze Menschheit wendet: «Seid trotz allem gegrüsst!»
Währenddessen, während die Menschen sich zurückziehen, um sich und ihre letzten Ressourcen zu verteidigen oder jene der anderen zu erobern versuchen; während sie sich in die Berge flüchten, wo die Hitze noch etwas weniger tödlich ist, bleibt Ramuz’ Sprache gelassen, urteilsfrei und neugierig, stets im Tonfall der einfachen Menschen oder in poetischen Naturbildern sprechend. «Durch die Felswand, die an die Weiden angrenzt, ging ein Zucken, wie wenn ein Pferd wegen der Fliegen seine Haut zucken lässt.» Der Berg als letzter Zufluchtsort erweist sich am Ende als genauso feindlich wie alles andere und stösst Mensch wie Tier wieder von sich ab.
Dasselbe Zucken geht durch unsere Gegenwart, und man braucht kein Prophet zu sein, um zu sehen, wo eine Lebensweise hinführt, die sich als getrennt von der «Natur» oder sich dieser gar als überlegen betrachtet. Diesen mehr als hundert Jahre alten Text zu lesen, der von unserer Gegenwart und Zukunft zu wissen scheint, ist eine unheimliche oder gar verstörende Erfahrung. Aber nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird.
Charles Ferdinand Ramuz: «Sturz in die Sonne». Übersetzt von Steven Wyss. Limmat-Verlag, Zürich 2023; 192 Seiten; 31.90 Franken.