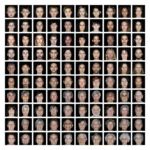Frau Stocker, Sie werden im Juli 75. Fühlen Sie sich alt?
Ja, ich bin müde. Ich spüre wirklich die Grenzen. Manchmal denke ich am Abend: Gott sei Dank muss ich nicht um 20 Uhr wieder irgendwo sein. Ich merke es auch, wenn mich die Enkel besuchen. Aber wenn ich den Leuten sage, ich sei eine alte Frau, denken alle, ich kokettiere. Die sind sich gar nicht gewohnt, dass Monika Stocker einmal nicht mag. (lacht)
Statistisch gesehen sind Sie noch nicht im hohen Alter, das beginnt erst mit 80.
Es ist schon verrückt, dass wir heute zwischen Alter und hohem Alter unterscheiden. Meine Grossmutter ist mit 75 gestorben – in einem schönen Alter, wie man damals sagte. Heute hiesse es: «Oh, die musste aber auch noch früh gehen.» Wir leben in einer Zeit, in der das hohe Alter für viele Menschen eine Option ist. Darauf können wir stolz sein. Aber anstatt uns darüber zu freuen, wird es in unserer Gesellschaft als Problem, als fast schon tragisches Ereignis angeschaut.
Sie meinen, weil uns dieses hohe Alter etwas kostet?
Ja, dabei geht oft vergessen, welche Leistungen die Alten volkswirtschaftlich erbracht haben und noch immer erbringen. Sie sind weiterhin Konsumenten und aktive Bürger. Sie haben 40 bis 50 Jahre gearbeitet, Steuern bezahlt, in die zweite und dritte Säule und die Krankenkasse eingezahlt. Unseren Wohlstand verdanken wir zu einem grossen Teil den heute alten Menschen.
Die 74jährige Monika Stocker ist diplomierte Sozialarbeiterin, diplomierte Erwachsenenbildnerin und hat einen Master in Angewandter Ethik sowie den Fähigkeitsausweis Fachjournalismus des MAZ. Sie arbeitete in verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit, dozierte an Ausbildungsstätten und war von 1987 bis 1991 Nationalrätin der Grünen. 1994 bis 2008 war sie Stadträtin in Zürich und leitete das Sozialdepartement. 2010 bis 2020 engagierte sie sich bei der Grossmütterrevolution, einer Gruppierung von älteren Feministinnen. Der Unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter stand sie zwischen 2013 und 2020 als Präsidentin vor. Die Autorin mehrerer Bücher ist verheiratet. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern sowie Grossmutter von zwei Enkelkindern und lebt in Zürich.
Die junge Bevölkerung sieht das teilweise anders. Immer weniger Junge müssen die Renten der Alten finanzieren — und gehen bei der eigenen Pensionierung womöglich leer aus.
Diese Kritiker vergessen, dass die AHV noch gar nicht so lange selbstverständlich ist. Meine Generation musste teils noch für die AHV der Vorgängergeneration aufkommen, weil diese noch gar nichts eingezahlt hatte. Dass sich die Alten ständig anhören müssen, sie seien zu teuer, ist hart. Gerade für jene, die viel ehrenamtliche Arbeit leisten: in einer Behörde, in der Kirche, beim Hüten der Enkelinnen, in der Care-Arbeit …
… die häufig von Frauen geleistet wird.
Vor allem von Frauen. Auch dieses Thema wird bei der Rentendiskussion völlig ausgeblendet. Mit 23 älteren Frauen habe ich einmal an einem Experiment teilgenommen. Wir haben ausgerechnet, wie viele Stunden wir im letzten Monat an Care-Arbeit geleistet haben. Bei einem Stundenansatz von 30 Franken kamen wir auf einen Gesamtbetrag von 1,2 Millionen Franken. Nicht dass das ausbezahlt werden müsste. Aber wenn ich dann gleichzeitig von einem jungen Schnösel im Fernsehen höre, dass die Alten zu teuer seien, kann man schon ein wenig aggressiv werden.
Fehlt Ihnen die Wertschätzung?
Ja, vor allem für die nicht bezahlte Arbeit. Ich erinnere mich an eine ältere Frau, der ich noch als Sozialvorsteherin der Stadt Zürich begegnete. Sie bezog Zusatzleistungen und sagte zu mir: «Wissen Sie, ich habe halt nichts gearbeitet.» Als ich sie zu ihrer Situation befragte, stellte sich heraus, dass sie drei Kinder grossgezogen, dem Mann den Rücken freigehalten, in der Kirchgemeinde Altersnachmittage organisiert und die Schwiegereltern gepflegt hatte.
Was sagten Sie ihr?
«Sie haben nicht nichts gearbeitet. Sie haben keine bezahlte Arbeit geleistet – das ist das Problem.» Und natürlich ungerecht. Nicht bezahlte Care-Arbeit müsste rentenbildend sein. Damit meine ich nicht, dass sie sofort als Lohn ausbezahlt werden soll, sondern dass sie gutgeschrieben wird.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Sagen wir, Frau Surber leistet in einer Non-Profit-Organisation oder in der Kirche 100 Stunden Freiwilligenarbeit. Dann sollte ihr das auf ihrem AHV-Konto gutgeschrieben werden – oder in einer 4. Säule.
Wozu eine 4. Säule?
Als weitere Säule für geleistete Freiwilligen- oder Care-Arbeit. Von diesen Stunden würde man in der Rente profitieren. Man könnte beispielsweise ausrechnen, wie viel diese Stunden in Franken wert sind und diesen Betrag dann der AHV anrechnen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man durch die geleistete Care-Arbeit Gutschriften oder Rabatte für im Alter selbst benötigte Betreuungsleistungen erhält. Ich habe an der Frauensession 2021 einen entsprechenden Antrag gestellt. Ein paar junge Frauen fanden den Gedanken spannend, aber mehrheitsfähig war er leider nicht.
«Das Trennen von Pflege und Betreuung war ein grosser Fehler und ist auch fachlich falsch.»
Warum nicht?
In der Schweiz – das ist auch die Doktrin der traditionellen Linken – gilt nur Lohnarbeit als Arbeit. Doch das ist ein Denkfehler. Keine Gesellschaft kann nur mit Lohnarbeit existieren. Hinzu kommt unser Wahn von Autonomie. Wir leben in einer Ego-Kultur, in der vergessen geht, dass jeder Mensch auf Hilfe angewiesen ist – vom Baby bis zum Greis. Das Bedürftig-Sein ist dem Menschen inhärent.
Das merken viele erst, wenn es ihnen selber schlechtgeht.
Das liegt auch daran, dass uns immer nur Bilder von tüchtigen Senioren gezeigt werden: von Leuten, die noch den «Engadiner» laufen oder was weiss ich. Oder von denjenigen, die genug auf dem Konto haben und sich Spitex, Privatpflege oder eine Seniorenresidenz leisten können. Aber das ist nicht die Norm. Was ist mit den Alten, denen das Geld dazu fehlt? Die allenfalls auch keine Familienangehörigen haben, die sich um sie kümmern können oder wollen?
Dazu haben wir doch Pflegeeinrichtungen und zahlen Krankenkassenbeiträge.
Pflegeleistungen werden übernommen, aber nicht die Betreuung im Alltag. Wer hilft beim Einkaufen, in der Hauswirtschaft oder bei Administrativem? Wer ist da, wenn jemand ein Gegenüber braucht, das ihm zuhört? Ich rede von Fürsorge und Zuwendung. Beides ist nicht abgedeckt. Bei der Revision des Krankenversicherungsgesetzes 2011 hat man nur die Pflege geregelt. Das Trennen von Pflege und Betreuung war ein grosser Fehler und ist auch fachlich falsch.
Wieso?
Betreuung ist Bestandteil einer fachlich professionellen Pflege. Dass man dies trennt, ist mitunter ein Grund dafür, dass sich viele Fachkräfte ausgelaugt fühlen und ihren Beruf verlassen.
Kennen Sie solche Fachkräfte?
Ich habe mich einmal mit einer Pflegerin unterhalten, die enttäuscht ihren Beruf verlassen hatte. Sie zeigte mir die Hochglanzbroschüre des Heims, in dem sie arbeitete. Darin standen wohlklingende Begriffe wie «schönes Zuhause» und so weiter. Sie sagte, man müsse eigentlich draufschreiben: «Wir geben Ihnen zu essen und wechseln die Windeln: Für mehr haben wir keine Zeit.» Was ist das für eine Gesellschaft, in der älteren Menschen nur noch das gegeben werden kann!
Eine geplante Volksinitiative mit dem Titel «Gutes Alter für alle» will das ändern. Der Staat soll sich nicht nur um Pflege-, sondern auch um Betreuungsaufgaben kümmern.
Ich unterstütze diese Initiative. Auch weil sie den Blick öffnet und die breite Öffentlichkeit vielleicht darüber nachdenken lässt, was gutes Alter bedeutet und wie wir mit alten Menschen umgehen wollen.
«Niemand will, dass jemand sagt: ‹Komm, Müeterli.›»
Wie könnte eine solche Initiative konkret umgesetzt werden?
Indem man beispielsweise regionale Dienstleistungszentren aufbaut, in denen Senioren in Altersfragen beraten werden: wenn sie einen Besuchsdienst brauchen, ein Altersheim suchen oder Hilfe im Alltag benötigen. Die Zentren würden vermitteln und wären vernetzt mit gemeindeeigenen Institutionen, Freiwilligenorganisationen oder Nachbarschaftshilfen. In kantonalen Pflegegesetzen wird das zum Teil auch gefordert, doch die Realisierung lässt zu wünschen übrig. Ein Punkt wäre dabei ganz wichtig.
Welcher?
Dass beraten und nicht angeordnet wird. Ältere Menschen wollen ernst genommen werden – auch wenn sie nur noch stumm dasitzen oder auf Rollatoren angewiesen sind. Niemand will, dass jemand sagt: «Komm, Müeterli.»
Wo findet man die Mitarbeitenden, die diese zusätzlichen Betreuungsaufgaben übernehmen? In dieser Branche ist es doch heute schon schwierig, die offenen Stellen zu besetzen.
Viele Menschen wollen in der Schweiz arbeiten, denken Sie nur an die Asylsuchenden und die Sans-papiers. Denen verbieten wir das Arbeiten, obwohl viele von ihnen gerne in der Care-Arbeit, in der Unterstützung von Fachpersonal hervorragende Arbeit leisten würden.
Und wie sollen Personal und Zentren finanziert werden?
Wenn es mehr Kinder gibt in einer Gemeinde, baut man Schulhäuser und sucht Lehrpersonen. Wenn es mehr Verkehr gibt, baut man – leider – Strassen. Wenn es mehr alte Menschen gibt, reden aber alle vom Sparen. Dabei ist das Geld dazu vorhanden. Die Frage ist, wofür man es ausgibt und wo man Prioritäten setzt. Solange Grossbanken gerettet und Armeeausgaben verdoppelt werden können, kann man sich auch Dienstleistungszentren für Senioren leisten.
Wie stufen Sie die Chance einer Volksinitiative «Gutes Alter für alle» ein?
Es wird schwierig, weil die Alten keine Lobby haben, zum Beispiel im Vergleich zu den Landwirten. Ich sage jeweils: In Bern ist jede Kuh besser vertreten als eine Rentnerin.
Der Anteil alter Menschen ist gross in der Schweiz. Wieso wehren sie sich nicht?
Viele schämen sich zuzugeben, dass sie es allein nicht mehr schaffen. In unserer Gesellschaft gilt das Motto: Den Tüchtigen gehört die Welt – und wer abgehängt wird, ist eben selbst schuld. Gerade habe ich gelesen, wie viele Rentnerinnen aus Scham ihre Ergänzungsleistungen nicht beanspruchen, obwohl sie Anrecht darauf hätten. Und das andere ist: Im Alter mag man nicht mehr kämpfen und rebellieren. Darauf verlässt sich die Politik.
Und Sie? Möchten Sie noch kämpfen?
Ich bin ja oft für Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit auf die Strasse gegangen, habe im Nationalrat und im Stadtrat für die Grünen politisiert und mich zuletzt in der Grossmütterrevolution engagiert. Jetzt bin ich nicht mehr aktiv. Die Jüngeren sollen ran.
Sie sind Ehrenmitglied der Grünen. Besuchen Sie die Parteiversammlungen?
Nein, ich zahle nur noch Mitgliederbeitrag. Werde ich angefragt, gebe ich gerne Auskunft oder helfe. Ich fühle mich dann ja auch geschmeichelt. Aber man muss irgendwann schweigen können.

«Wenn ich in eine andere Zeit oder ein anderes Leben eintauchen kann, ist das für mich wie eine Begegnung»: Monika Stocker in ihrer Wohnung in Zürich.
Wenn Sie nicht mehr politisieren: Wie sieht Ihr Tag aus?
Ich lese viel, das habe ich schon immer gerne gemacht. Wenn ich in eine andere Zeit oder ein anderes Leben eintauchen kann, ist das für mich wie eine Begegnung. Mein Mann sammelt leidenschaftlich gerne Bücher. Deshalb können wir aus dieser Wohnung, die ebenso eine Bibliothek ist, nicht mehr raus. (lacht)
Das müssen Sie vermutlich auch nicht. Als ehemalige Stadträtin dürften Sie heute in einer privilegierten Situation sein.
Das stimmt. Ich hatte viel Glück im Leben.
War das immer so?
Mein Mann und ich sind Sozialarbeiter. Er hat ursprünglich Theologie studiert und war vermutlich einer der ersten Hausmänner in der Schweiz. Wir hatten anfangs wenig Geld. Doch wir kamen über die Runden. Das war eine wertvolle Grunderfahrung. Als Stadträtin habe ich dann gut verdient. Heute haben wir eine Eigentumswohnung in Zürich und ein Refugium in der Innerschweiz.
Reisen Sie?
Mein Mann und ich sind keine Reisejunkies, da ticken wir zum Glück gleich. Wir vermissen es auch nicht. Wir haben die Welt hier in all diesen Tausenden von Büchern sowie in der Natur rund um unsere Ferienwohnung. Letzteres ist ein totaler Luxus, der mir während aller Stressjahre auch den Psychiater erspart hat.
Inwiefern?
Ich schreibe dort, meditiere, sinne über das Leben nach und besuche mich ab und zu selbst: eine wichtige Lebensqualität im Alter.
Sie besuchen sich?
Ich habe eine Freundin, die bald 100 Jahre alt ist. Sie erzählte mir einmal, dass sie jeden Tag einen Besuch bei sich selber mache. Sie setzt sich hin mit einer Tasse Tee und schaut, was mit ihrem Leben ist, spaziert so quasi durch ihre Lebensjahrzehnte. Das ist doch schön. Seither mache ich das auch.
Jeden Tag?
Nein, unregelmässig. Letzten Sommer bin ich für zwei Monate allein in unser Refugium gefahren und habe Tagebuch geschrieben, um mich zu besuchen und mit ein paar Dingen abzuschliessen.
Womit?
Vor dem Ende meiner Amtszeit als Stadträtin hat die «Weltwoche» eine Kampagne gegen mich gefahren. Es ging um angebliche Missstände in der Sozialhilfe. Durch das folgende Politmobbing wurde ich krank. Noch heute leide ich unter den Folgen, die ich nicht mit ins hohe Alter nehmen will. Ich wollte aufräumen und habe meine Gedanken dazu niedergeschrieben. Einfach für mich.
Haben Sie schon immer geschrieben?
Ich wollte in jungen Jahren Germanistik studieren, Autorin werden, fand das aber – Realistin, die ich bin – zu brotlos. Geschrieben habe ich dennoch immer wieder. Nach der Pensionierung habe ich auch Bücher herausgegeben, unter anderem über das Alter. Und ich führe ein Tagebuch für meine Urenkel, die ich wohl nicht mehr kennenlernen werde.
Was schreiben Sie ihnen?
Ich möchte ihnen erklären, was beispielsweise Corona oder der Krieg in der Ukraine auslöst, schreibe über die Umweltfrage und das Leben heute. Aber diese Zeilen sind privat und nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ich schreibe auch Monatsbriefe. Zum Beispiel an Gianni Infantino und die Fifa oder an den Papst. Die verschicke ich dann an eine Zahl von Leserinnen und Lesern. Das Schreiben zwingt mich, gewisse Themen durchzudenken und offen zu bleiben.
Dann sind Sie in gewisser Weise ja doch noch politisch aktiv?
Mir ist schon wichtig, nicht nur dazusitzen. Ich muss aber auch nicht mehr alles verstehen – die Bankenfusion zum Beispiel.
«Ich bin mit Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung politisiert worden. Und das bleibt.»
Sie stammen aus einem katholischen Elternhaus. Gehen Sie noch in die Kirche?
Ich hatte eine katholische Erziehung, aber in die Kirche gehe ich nicht mehr. Während Jahren litt ich unter dem Dilemma, katholisch und Feministin zu sein. 2019, als der Papst sagte, Abtreibung sei vorsätzlicher Mord, hat’s mir gereicht. Das ist ein liebloser Satz, den nur ein Patriarch sagen kann, der gar nichts von Sorgen und Nöten der Frauen versteht. Ich bin zusammen mit ein paar anderen Frauen, die man aus der feministischen Theologie kennt, aus der Kirche ausgetreten. Auch weil ich gemerkt habe, dass die katholische Kirche offenbar nicht lernfähig ist.
Sind Sie in eine andere Kirche eingetreten?
Ich habe Offerten bekommen, von der reformierten und der christkatholischen Kirche. Beide habe ich abgelehnt. Für mich ist das Religiöse eine Realität, eine Heimat, für das ich keine Organisation brauche.
Beten Sie?
Ja. Religion ist bei mir aber nicht ritualisiert. Es ist vielmehr eine Grundhaltung, die sich in Dankbarkeit, Vertrauen und einem Verbunden-Sein mit der Welt äussert. Ich bin mit Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung politisiert worden. Und das bleibt.
Fürchten Sie sich vor dem Sterben?
Ich habe keine Angst, aber ich befasse mich schon mit dem Tod. Ich will mich darauf vorbereiten, wie ich einmal Abschied nehmen will.
Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Zusammen mit meinem Mann. Wir haben einen Vorsorgeauftrag verfasst und ihn mit den Kindern besprochen. Ich habe auch eine Todesanzeige entworfen und bin Mitglied der Sterbehilfeorganisation Exit. Ich habe ein paar Todesfälle erlebt, bei denen ich dachte: Dieses Leiden hätte jetzt nicht mehr sein müssen. Wer weiss, was mit mir passiert? Falls ich leiden muss, will ich sagen können: So, ich mag nicht mehr. Auch um meine Angehörigen zu schützen.
Was kommt nach dem Tod?
Zuerst einmal Ruhe. Der Körper ist weg. Aber was bleibt übrig? Und was ist mit den Milliarden Menschen, die schon gestorben sind? Gibt es die? In Form von Energie? Wärme? Liebe?
Was denken Sie?
Es ist ein Geheimnis – und bleibt eins. Und ich muss es auch nicht wissen. Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich nach dem Tod meine Mutter wieder treffe. Ich begegne ihr, wenn ich an sie denke.
Könnten Sie sich vorstellen, in einem Altersheim zu wohnen?
Auf jeden Fall. In einer eigenen Wohnung zu leben ist zwar schön und ich geniesse es. Aber eventuell ist das irgendwann nicht mehr möglich. Ich habe keinen Schrecken vor Heimen. Dort wird hervorragende Arbeit geleistet. In der Generation meiner Eltern hiess es noch: «Dann musst du ins Heim.» Das klang wie eine Drohung.
Und heute?
Heute kann man, solange man nicht schwer erkrankt ist, in der Regel wählen. Auch weil man vielleicht den Haushalt nicht mehr machen mag. Oder weil man lieber ein schönes Essen aufgetischt bekommt, anstatt selber zu kochen.
Viele ältere Menschen bevorzugen es, daheim zu bleiben …
… und müssen womöglich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin gepflegt werden.
Was ist daran falsch?
Nichts, solange das beide wollen und können. Wenn ich von sogenannten Heldinnengeschichten à la «Sie hat ihn bis in den Tod begleitet» lese oder höre, denke ich jeweils: Da hat wohl jemand gelitten.
Sie meinen die Frau?
Nicht unbedingt. Wenn die Ehefrau plötzlich über ihren betagten Ehemann denkt: «So, jetzt gehört er mir», dann kann das auch unschön enden.
Kennen Sie solche Fälle aus Ihrer Zeit als Präsidentin der Unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter?
Oh ja. Ich habe erlebt, was geschehen kann, wenn jemand mit der Betreuung seines Lebenspartners oder Elternteils überfordert ist. Da kann viel Schaden angerichtet werden.
«Mein Mann ist 80, wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Und ich werde ihn nicht pflegen.»
Durch Gewalt?
Ja, und ich rede nicht nur von einem blauen Auge, sondern von psychischer Gewalt: Verletzendes, Kränkendes, Abwertendes. So soll kein Mensch sein hohes Alter verbringen müssen – womöglich noch in Angst vor der Partnerin oder dem Partner.
Wie können solche Situationen verhindert werden?
Indem man sich Hilfe holt und sich sagen lässt: «Du hast das Recht, deinen Mann ins Heim zu bringen. Du bist deswegen keine schlechte Ehefrau.» Das hat auch etwas Befreiendes und kann Beziehungen retten.
Wie ist das bei Ihnen und Ihrem Mann?
Mein Mann ist 80, wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Und ich werde ihn nicht pflegen.
Weiss er das?
Natürlich. Er weiss auch, dass ich es nicht von ihm erwarte. Sollte ich pflegebedürftig werden, gehe ich ins Heim. Und wünsche mir einfach, dass mich mein Mann, sofern möglich, so oft wie möglich besucht und vielleicht eine gute Flasche Wein mitbringt – oder Jasskarten.
Monika Stocker, Kurt Seifert (Hg.): «Alles hat seine Zeit — Ein Lesebuch zur Hochaltrigkeit.» Mit Illustrationen von Vroni Grütter-Büchel. tvz 2015; 128 Seiten; 21 Franken.