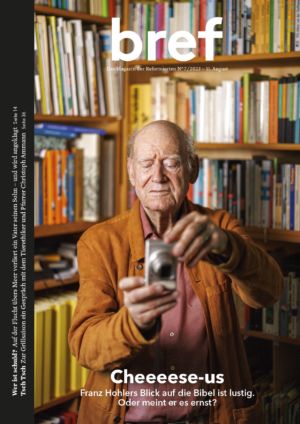Arbeit
Während Adam und Eva noch das steinige Feld beackerten, verhandeln die jungen Frauen und Männer von heute selbstbewusst über Teilzeitarbeit und Homeoffice. Das ist ein gewaltiger Schritt in einer Kultur, die die protestantische Arbeitsethik tief verinnerlicht hat. Immerhin hatten die Reformatoren erkannt, dass es in einem Leben nicht nur Fron zur Sündenabtragung geben kann, sondern dass es auch des Trostes und der Hoffnung auf eine Sinnerfüllung im Diesseits bedarf. So verwandelten sie die biblische Strafe für unseren Missgriff im Garten Eden in einen Leistungsanreiz: Belohnt werden sollten jene, die rechtschaffen und bescheiden ihr Tagwerk verrichten, ohne zu murren. Fleiss galt mehr als Klugheit, Disziplin und Effizienz.
Bis heute organisiert sich das Leben vieler Menschen um die Arbeit herum, Freizeit dient vor allem der Wiederherstellung der Arbeitskraft. Gerade bei den älteren Generationen meldet sich das schlechte Gewissen, wenn sie dem eigenen Arbeitsethos nicht gerecht werden, der noch in Hierarchien denkt. Schnell fühlt man sich als Tagedieb, wenn man lieber auf der faulen Haut liegt, statt die eigne Haut zu Markte zu tragen.
Mit den Digital Natives beginnt sich das zu verändern: Sie werfen zu Recht die Frage auf, ob es noch gerechtfertigt ist, dass die Arbeitswelt so viel Platz einnimmt in unserem Leben. Sollte sie nicht besser Raum geben für mehr sinnerfüllende Betätigungen, die vielleicht sogar die Gesellschaft weiterbringen? Neue Technologien entkoppeln die Arbeit von Zeit und Raum zumindest in globalisierten Unternehmen, wo eine körperliche Präsenz nicht nötig ist. In Zeiten des Fachkräftemangels können sich die Job-Nomaden die besten Angebote aussuchen. Aber auch in Berufen, in denen die Belastung an körperliche und seelische Grenzen stösst, ist inzwischen eine ausgewogene Life-Work-Balance Thema, dem sich die Arbeitgeber stellen müssen.
Die Wirtschaft hat verstanden: Die Zukunft der Arbeit bedeutet flachere Hierarchien und mehr Möglichkeiten, sein kreatives Potenzial zu verwirklichen. Gewisse Politikerinnen und Politiker dagegen bekunden Mühe mit diesem Paradigmenwechsel. Sie werfen den jungen Arbeitenden Freizeit-Fixiertheit vor. So verstieg sich die Vorstandsvorsitzende der deutschen Bundesagentur für Arbeit zu dem Satz: «Arbeit ist kein Ponyhof.» Von Pferden versteht sie nichts. Einen Ponyhof zu betreiben erfordert viel Ausdauer und Kraft. Und das 365 Tage im Jahr. Adam und Eva könnten ihr erklären, was das heisst.