«Ich würde ja schon weniger Fleisch essen, aber Soja aus Brasilien ist auch nicht besser.»
Endlich ist Sommer und damit wieder Grillzeit! Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, als an einem lauen Abend ein leckeres Steak zu brutzeln. Wer den heissen Rost mit Bratwürsten und anderen Fleischprodukten belegt, wird heutzutage allerdings schnell einmal als Klimasünder abgestempelt. Überzeugte Karnivoren verweisen dann gerne darauf, dass auch Fleischersatzprodukte ihre Tücken haben. «Mit euren Tofuwürsten ruiniert ihr den Regenwald!», schallt es manchem Vegetarier entgegen.
Tatsächlich ist der Anbau von Soja, aus dem viele Fleischalternativen bestehen, problematisch. Laut einer Studie des WWF wurden zwischen 2001 und 2015 mehr als acht Millionen Hektar Wald und Savanne für Sojafelder abgeholzt. In Brasilien, einem der Hauptproduzenten, haben die riesigen Monokulturen aber nicht nur verheerende Auswirkung auf das Ökosystem. Sie verdrängen zunehmend auch die traditionellen Kleinbauern.
Aus dem Schneider sind die Fleischesser deshalb aber nicht. Rund 80 Prozent der globalen Sojaernte endet nämlich als Tierfutter und somit in der Fleischproduktion. Kommt hinzu, dass die Herstellung von Fleisch ohnehin mehr Ressourcen verbraucht als diejenige pflanzlicher Kost. Denn Nutztiere benötigen grosse Mengen an Futter, Wasser und Weidefläche. Entsprechend schlecht ist ihre Umweltbilanz: Laut einer Studie des deutschen Umweltbundesamtes werden bei der Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch rund zehnmal mehr Treibhausgase ausgestossen als bei der entsprechenden Menge Fleischersatz. no
«Ich selber könnte ohne Probleme auf Milch und Fleisch verzichten. Aber den Kindern würden Proteine und Kalzium fehlen.»
«Ein Klassiker unter den Ausreden», sagt Manuela Jäggi, die beim Schweizerischen Verband der Ernährungsberater/innen die Fachgruppe Nachhaltige Ernährungsweisen leitet. Tatsächlich sei es zwar so, dass der Bedarf an Proteinen gut über tierische Produkte gedeckt werden könne; das sei aber bei weitem nicht der einzige Weg. «Wer regelmässig Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Nüsse und Samen isst, der schafft das ebenso gut.» Auch komme Kalzium nicht nur in Milchprodukten vor. Gute pflanzliche Kalziumquellen seien zum Beispiel Sesam oder dunkelgrünes Blattgemüse. «Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte bei pflanzlichen Milchalternativen und Joghurts auf Kalziumzusatz geachtet werden», sagt Manuela Jäggi.
Damit sei eine Ernährung ohne Fleisch auch bei Kindern gut möglich. Ebenso eine vegane Ernährung, solange man sich über die Inhaltsstoffe der einzelnen Lebensmittel informiere und auf eine gute Abdeckung aller Nährstoffe achte. Um dies ideal umzusetzen, empfiehlt Jäggi, eine Fachperson beizuziehen. Aus ökologischer Sicht sei allerdings gar nichts dagegen einzuwenden, wenn gerade Kinder hin und wieder Milchprodukte essen würden, um ihren Kalziumbedarf zu decken. Vor allem wenn die Produkte aus der Schweiz stammten. «Wegen der vielen Berge gibt es hier viel Fläche, die gar nicht für den Ackerbau genutzt werden kann. Darum macht es Sinn, auf diesen Flächen Milchkühe zu halten, anders als beispielsweise in Holland.» Es komme allerdings auf die Menge an und leider stamme nur ein Bruchteil der Milchprodukte im Detailhandel von weidenden Alpkühen.
Laut Jäggi sind rund 30 Prozent der Umweltbelastung auf den Bereich Ernährung zurückzuführen, mehr als auf Mobilität oder Wohnen. Entsprechend gross sei hier der Hebel. Dabei sei ein Totalverzicht aber nicht nötig: «Wer sich zu 90 Prozent pflanzlich ernährt und dabei auf Flugimporte zum Beispiel von exotischen Früchten verzichtet, der hat schon sehr viel fürs Klima getan.» vbu

Klima, Kreuz und Karton
Nicht Technologien, sondern moralische Werte werden das Klima ...
«Vegetarisch kochen ist einfach viel aufwendiger. Dafür fehlt mir die Zeit.»
Zahlreiche Kochbuchautoren würden hier widersprechen. So etwa die beiden irischen Brüder Stephen und David Flynn, die sich für ihr Buch «The Veg Box» vom Modell des Gemüseabos haben inspirieren lassen: Man bekommt vom Hof seines Vertrauens drei Lauchstangen geliefert und hat erst einmal keine Ahnung, was man damit machen soll. Die Flynns präsentieren Lösungen für dieses Problem: Rezepte für zehn verschiedene Gemüse mit maximal zehn Zutaten, vom schnellen Burger bis zum simplen Brownie.
«Die meisten Menschen scheitern weniger an der Zeit als vielmehr am Gefühl, dass Fleisch einfach dazugehört – und am fehlenden Know-how», sagt auch Manuela Jäggi, Ernährungsberaterin SVDE und spezialisiert auf nachhaltige Ernährung. Viele hätten in der Kochschule oder von ihren Eltern gelernt, Fleisch zu kochen. Wie man Hülsenfrüchte richtig zubereitet, wüssten dagegen viele nicht. Hier rät Jäggi zum Ausprobieren: Den Tofu so lange würzen, bis er einem schmeckt, und dabei verschiedene Techniken versuchen. Oder die Bolognese statt mit Hackfleisch einmal mit roten Linsen zubereiten, die in fünf bis zehn Minuten gar sind.
Auch angesichts der vielen Ersatzprodukte, die derzeit auf den Markt kommen, sei die Zeit kein Argument mehr, findet Jäggi. «Vegi-Nuggets sind genauso schnell fertig wie Chicken-Nuggets. Wenn Sie diese Ihren Kindern vorsetzen und nichts dazu sagen – ich bin sicher, sie werden den Unterschied nicht merken.»
Allein: allzu oft sollte man solche hochverarbeiteten Lebensmittel nicht essen, da sie viel Salz und Fett enthalten. «Eine Vegi-Bratwurst ist nicht unbedingt gesünder als eine normale Bratwurst», sagt Manuela Jäggi dazu. Dann doch lieber kochen mit hochwertigen Zutaten. Inspiration gibt es in Büchern, im Fernsehen und auf Social Media mittlerweile genug. Nur darauf einlassen muss man sich. vbu
«Ich kaufe nur ausnahmsweise Erdbeeren im Winter. Dafür kommen mir sonst nur Bio-Produkte ins Haus.»
«Sooft ich sie kostete, hab’ ich gedacht, / Gott hat sie wohl nur für die Engel gemacht», dichtete der deutsche Poet August Heinrich Hoffmann von Fallersleben einst über die Erdbeere. Auch hierzulande erfreut sich die süsse Frucht grosser Beliebtheit, rund 24 000 Tonnen werden laut dem Schweizer Obstverband jedes Jahr konsumiert. Dabei schmecken Erdbeeren nicht nur köstlich, sie sind auch wahre Vitaminbomben. Kein Wunder, können wir nicht widerstehen, wenn Supermärkte bereits im Winter Erdbeeren aus Spanien, Israel oder Marokko anbieten.
Aus ökologischen Gründen sollten wir darauf jedoch lieber verzichten. Neben den langen Transportwegen ist es vor allem der gigantische Wasserverbrauch, der für eine schlechte Umweltbilanz sorgt. Im Hauptanbaugebiet in der südspanischen Provinz Huelva sollen laut einer Studie des WWF bereits Tausende von illegalen Brunnen entstanden sein, um die riesigen Plantagen zu bewässern. Der weltberühmte Doñana-Nationalpark, eines der grössten Feuchtgebiete Europas, droht deshalb gar auszutrocknen.
Auf vorsaisonale Erdbeeren aus der Schweiz zurückzugreifen ist klimatechnisch keineswegs besser. Im Gegenteil: Niels Jungbluth, Experte für Ökobilanz, hat festgestellt, dass Schweizer Erdbeeren aus dem beheizten Gewächshaus sogar eine noch grössere Klimabelastung darstellen als per Lkw importierte.
Wer sich dennoch Erdbeeren im Winter gönnt und dafür sonst nur Bio-Produkte einkauft, entlastet zwar sein Gewissen. Er tut aber nicht unbedingt der Umwelt einen Gefallen. Verschiedene Studien ergeben, dass Bio-Lebensmittel nicht zwingend klimafreundlicher sind – insbesondere dann, wenn sie importiert sind. Viel nachhaltiger ist es, regional und saisonal einzukaufen. Auf Erdbeeren müssen wir dann allerdings bis im Juni verzichten. Aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. no

«Manchmal geht’s nicht ohne Fliegen. Aber ich kompensiere ja meine Emissionen.»
Natürlich kommt man auch ohne zu fliegen in den hintersten Winkel dieser Welt. Die Frage ist bloss: Wie schnell und bequem? Denn einmal abgesehen davon, dass man noch vor dem Einsteigen Stunden anstehen, sich halb entblössen, warten und nochmal warten muss, um sich dann in viel zu enge Sitze neben viel zu ungehobelte Nachbarn zu quetschen, bevor man völlig dehydriert mit Blähbauch und Thrombose am Zielort ankommt, ist das Flugzeug tatsächlich ein schnelles und praktisches Transportmittel. Das Problem ist nur, dass es wie kein anderes CO2 ausstösst. Die Fliegerei ist weltweit für rund 7 Prozent des Treibhausgasausstosses verantwortlich, in der Schweiz sogar für 27 Prozent.
Laut WWF verursacht ein einzelner Passagier mit einem Hin-und-Rückflug zwischen Paris und New York Emissionen im Umfang von 3,2 Tonnen CO2. Das ist ungefähr dreimal so viel wie der durchschnittliche jährliche CO2-Fussabdruck einer Person aus Uganda. Diese Emissionen kann man zwar kompensieren, jedoch nicht ungeschehen machen.
Beim Kompensieren kauft man in der Höhe des verursachten Treibhausgasausstosses sogenannte Emissionsminderungsgutschriften, auch Zertifikate genannt. Mit dem eingenommenen Geld werden Klimaschutzprojekte finanziert, indem beispielsweise erneuerbare Energien gefördert oder Wälder aufgeforstet werden, um die entsprechende Menge an CO2-Emissionen auszugleichen. Es lässt sich allerdings nur schwer überprüfen, wie klimafreundlich diese Kompensationen sind. Wie eine grosse Recherche verschiedener namhafter Medien ergab, gibt es viele «Schrott-Zertifikate», mit denen gar keine tatsächliche Klimawirkung erzielt wird. Dieses sogenannte Greenwashing ist möglich, weil der Markt der freiwilligen CO2-Kompensationen ungenügend reguliert wird.
Dennoch: Wenn sich ein Flug nicht vermeiden lässt, ist es laut WWF immer noch besser, ein Klimaschutzprojekt möglichst grosszügig zu unterstützen, als gar nichts zu tun. Zusammen mit weiteren NGO hat die Natur und Umweltschutzorganisation ein Prüfsiegel für Kompensationen entwickelt. Projekte mit diesem Gold-Standard vereinen laut WWF Emissionsreduktionen mit den UN-Nachhaltigkeitszielen und wirken sich nachweislich positiv auf den Klimaschutz aus. hz
«Ich kann nichts dafür, ich muss geschäftlich fliegen.»
Die Zahl der geschäftlich fliegenden Passagiere ist in der Schweiz deutlich kleiner als jene der Personen, die ferien- und freizeithalber ein Flugzeug besteigen. Gemäss dem Mikrozensus Mobilität und Verkehr betrug der Anteil der Geschäftsreisen im Jahr 2015 rund 14 Prozent. Im Corona-Jahr 2021 sank er gar auf unter 8 Prozent. Doch auch dieser Wert liesse sich verringern: Die Pandemie hat gezeigt, dass Geschäftsbeziehungen häufig per Telefon und Videokonferenzen gepflegt werden können. In vielen Fällen könnte also problemlos auf Geschäftsflüge verzichtet oder auf klimaverträglichere Transportmittel umgestiegen werden, insbesondere auf kurzen Distanzen.
Laut dem Bundesamt für Statistik steuern 80 Prozent der Schweizer Flugpassagiere Ziele in Europa an. Viele davon sind mit der Bahn zu erreichen. Wählt man beispielsweise von Zürich nach Berlin den Zug statt den Flieger, wird laut WWF Schweiz das Klima dreissig Mal weniger belastet. Sicher, auch Zugreisen können anstrengend sein – und die Deutsche Bahn ist nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Doch in der Regel lässt es sich im Zugabteil angenehmer arbeiten als im Flugzeug. hz

«Solange die Chinesen ständig neue Kohlekraftwerke bauen und die Brasilianer den Regenwald abholzen, bringt es nichts, wenn wir hier in der Schweiz Bus fahren oder auf unser Steak verzichten.»
«Diese Aussage hat einen wahren Kern, denn wir können oft nicht genau wissen, ob unser Verzicht etwas bewirkt», sagt Philosoph Nico Müller. Aber Verhaltensweisen könnten auch anständig und richtig sein, ohne etwas zu bewirken. Müller hält es mit Immanuel Kant: Wir sollten das tun, was wir für richtig halten, das ist wahre Autonomie. «Natürlich ist es für das Klima wichtig, dass auch China auf Kohlekraft verzichtet. Aber mir sollte trotzdem etwas daran gelegen sein, dass ich mich für meinen Teil anständig verhalte.» Wer seinen eigenen moralischen Kompass habe, zeige dadurch auch, dass er kein Mitläufer, sondern ein selbstbestimmter Mensch sei, der nach eigenen Prinzipien handelt. «Das ist doch eine wünschenswerte Charaktereigenschaft», sagt Müller. Nicht nur in Bezug auf den Klimawandel.
Grundsätzlich schwingt in der Ausrede auch ein falsch verstandener Hedonismus mit: Hier will jemand auf nichts verzichten müssen, auch nicht auf das Steak, nicht auf das Auto. Beim richtig verstandenen altgriechischen Hedonismus gehe es aber genau darum, bewusst zu geniessen und nicht jeder Lust oder Gewohnheit nachzugehen, sagt Müller. Hedonismus heisst also auch, grossen Genuss im Kleinen finden zu können. Ein wahrer Hedonist zeichne sich genau dadurch aus, dass er auch Linsensalat und Fahrradfahren geniessen könne.
Und übrigens: Klimaforscher Reto Knutti geht davon aus, dass China vor der Schweiz CO2-neutral sein wird, wie er kürzlich in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte. bat
«Ich kann das Klima sowieso nicht retten. Das ist Sache der Politik.»
Mit der Verantwortung ist es so eine Sache. Wenn es unbequem wird, wird sie gerne hin und her geschoben. Wer trägt die Verantwortung im Umgang mit der Umwelt und dem Klima? Die Politikerinnen und Politiker? Wir selbst? Zumindest für EVP-Nationalrat Nik Gugger ist die Antwort klar: «Wenn alle weltweit die Verantwortung weiterreichen, passiert nichts. Wer, wenn nicht wir aus der reichen und stabilen Schweiz, könnte Vorreiter sein?» Die Klima- und die Biodiversitätskrise müsse allerdings gemeinsam gelöst werden. «Jeder und jede muss selbst in den Spiegel schauen und sich fragen, was er oder sie zum Schutz des Klimas tun kann», sagt Gugger. Dabei brauche es keine Moralinsäure. «Wenn möglich Zug statt Flug, heisst etwa die Devise – vor allem innerhalb Europas.»
Auch die Politik spiele eine wichtige Rolle. Sie müsse beim Klimaschutz vorbildlich handeln. Gugger selbst versucht das zu tun, indem er im Parlament Brücken baut. «Zwischen Umweltschutz und Wirtschaft», wie er sagt.
Dass Politik und Bevölkerung Hand in Hand arbeiten können, um den Klimaschutz zu verstärken, zeigte sich am 18. Juni. Die Stimmberechtigten haben sich an der Urne mit 59,1 Prozent für das neue Klimaschutzgesetz entschieden, das wiederum vom Parlament ausgearbeitet worden war. Bis 2050 sollen in der Schweiz die Treibhausgasemissionen netto auf null reduziert werden. Die Stimmbeteiligung lag bei 42 Prozent. Welche Ausrede die restlichen 58 Prozent hatten, die nicht an die Urne gingen, ist nicht bekannt. bat
«Autos werden immer sparsamer. Und mit meinem E-Auto bin ich schon auf der grünen Seite.»
Richtig ist, dass Fahrzeugmotoren effizienter werden. Nur: das macht den Verkehr insgesamt nicht grüner, weil gleichzeitig mehr Menschen auf grössere und schwerere Fahrzeuge wie SUV umsteigen. Dies sei durch Studien belegt, sagt Mobilitätsexperte Thomas Sauter-Servaes. «Und damit verpufft der Nachhaltigkeitseffekt.»
Auch wer ein E-Auto fährt, sollte sich nicht als Klimaschützer aufspielen. «Vergessen wird meist, dass für die Herstellung einer Autobatterie unglaublich viel CO2 benötigt wird», sagt Sauter-Servaes. Er rechnet vor, dass eine durchschnittliche Batterie in der Herstellung ungefähr 4,5 Tonnen CO2 benötigt. Um die Klimaziele zu erreichen, hat jeder von uns bloss ein Budget von 0,6 Tonnen CO2 – pro Jahr. Mit dem Kauf eines neuen E-Autos ist also der CO2-Vorrat für die nächsten sieben bis acht Jahre aufgebraucht, ohne überhaupt einen Millimeter gefahren zu sein.
Sauter-Servaes stellt klar: «Wir brauchen neben der Antriebswende auch eine Mobilitätswende.» Oder anders gesagt: Die Technologie alleine wird es nicht richten. Wir müssen nicht nur anders unterwegs sein, sondern vor allem weniger. In der Nähe des Arbeitsortes wohnen, im Quartier einkaufen und Ferien in der Nähe verbringen, statt mit dem Flugzeug zu verreisen. Damit wir das auch tun, braucht es gemäss dem Mobilitätsexperten nicht einzig unseren Willen zur Veränderung, sondern auch die dafür geeignete Infrastruktur sowie die richtigen Anreize. eba
«Ich bleibe bei meinem Diesel. Würden alle auf E-Autos umsteigen, würde einfach der Strom knapp.»
Klar ist: E-Autos haben die bessere Umweltbilanz als Autos mit Verbrennungsmotor. Über den ganzen Lebenszyklus betrachtet verbrauchen sie laut Studien nur rund die Hälfte an CO2. Trotzdem rät der Mobilitätsforscher Thomas Sauter-Servaes davon ab, deswegen nun panisch den eigenen Diesel zu verschrotten und ein neues E-Auto zu kaufen. Denn die Herstellung einer Autobatterie verbraucht enorm viel CO2 (siehe letzte Ausrede). «Besser fürs Klima ist, wenn Sie Ihr altes Auto ausfahren», sagt er.
Der Umstieg kann danach erfolgen – und wird es auch, wenn man den Prognosen des Bundes glaubt. Dieser rechnet damit, dass bis 2050 rund 3,6 Millionen Elektroautos auf Schweizer Strassen unterwegs sein werden. Heute sind es etwa 110 000. Damit werden wir für den Verkehr massiv mehr Strom benötigen – gemäss Bund sind es rund fünfmal so viel wie heute.
Doch ein Grund zur Panik ist das nicht. Denn längst nicht in allen Bereichen werden wir derart viel mehr Strom brauchen, um CO2 einzusparen. In der Industrie rechnet der Bund durch Effizienzgewinne sogar mit einer deutlichen Abnahme des Verbrauchs. Total werden wir darum bis 2050 gemäss den Prognosen «nur» rund 11 Prozent mehr Strom benötigen.
Diesen zusätzlichen Bedarf müssen erneuerbare Energien decken – was zwar ambitioniert, aber möglich ist. Voraussetzung dafür ist, dass die notwendigen Massnahmen ergriffen werden. Oder wie es der Klimaforscher Reto Knutti im «Tages-Anzeiger» ausdrückte: «Ob wir genug Strom haben werden, ist – wie zahlreiche Studien zeigen – nicht eine Frage der technischen Machbarkeit, sondern eine politische.» eba
«Ich würde gerne aufs Auto verzichten. Aber Fahrradfahren ist viel zu gefährlich und die Züge sind zu voll.»
Es ist eine Binsenwahrheit: Klimafreundlich mobil sein heisst weniger mit Flugzeug und Auto, dafür mehr mit ÖV, Velo und zu Fuss unterwegs sein. Doch gibt es Gründe, die dagegen sprechen, das Lenkrad gegen ein Zweirad einzutauschen. Einer davon ist tatsächlich die Unfallgefahr. Das Risiko, mit dem Fahrrad tödlich zu verunglücken, ist rund zwölf Mal höher als mit dem Auto, wie der «Taschenstatistik Verkehrsunfälle» des Bundesamts für Strassen zu entnehmen ist. Gefährlicher als das Velo ist einzig das Motorrad.
Dann also doch auf den Zug umsteigen? Dieser ist gemäss besagter Statistik nämlich das mit Abstand sicherste Verkehrsmittel – in Bezug zu den zurückgelegten Kilometern 1096 Mal sicherer als das Fahrrad. Doch wer im Morgenverkehr pendelt, weiss: Zu Stosszeiten ist der öffentliche Verkehr mancherorts bereits heute total überlastet. Immerhin: Besserung ist in Sicht. Der Bund plant mit dem Projekt BAHN 2050 einen Ausbau der Infrastruktur im grossen Stil. Er rechnet damit, dass alleine dadurch rund drei Prozent der Autofahrer auf den Zug umsteigen werden – das ist nicht viel, aber immerhin.
Denen, die über volle Züge nörgeln, hält Mobilitätsexperte Thomas Sauter-Servaes zudem entgegen, dass die Kapazitätsengpässe auf Stosszeiten und bestimmte Strecken beschränkt seien. «Wer zeitlich flexibel oder im Homeoffice arbeiten kann, muss sich das nicht antun.» Dass nicht jeder umsteigen kann, sei klar. Über finanzielle Anreize wie Mobility-Pricing könnten jedoch noch einige dazu bewogen werden.
Und das Sicherheitsproblem beim Velofahren? Für den Mobilitätsforscher vor allem ein Argument dafür, die dominante Stellung des Autoverkehrs in der Stadt zu hinterfragen und den Nahverkehr zu stärken. eba
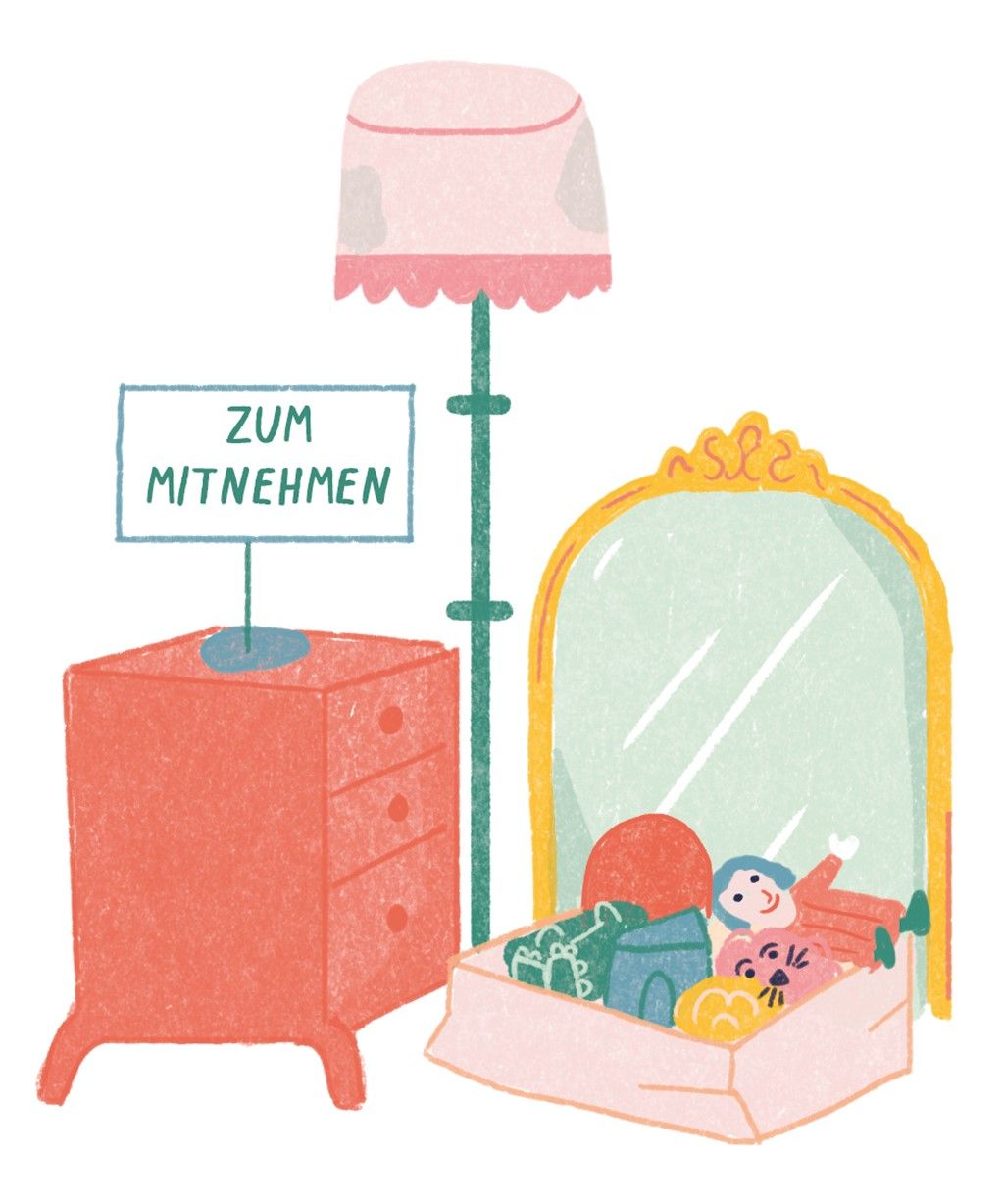
«Weniger wegwerfen — da bin ich absolut dafür. Aber heutzutage repariert ja niemand mehr solche alten Dinger, und am Ende kommt mich das ohnehin teurer.»
Stabmixer, Spielkonsole, Staubsauger: Die Schweizerinnen entsorgen jährlich pro Kopf 23 Kilo Elektroschrott und landen damit weltweit auf Platz drei. Tatsächlich sei es oft viel teurer, einen Gegenstand zu reparieren, als ihn neu zu kaufen, sagt Sara Zeller, Kuratorin der Ausstellung «Repair Revolution!» im Museum für Gestaltung in Zürich. «Wir sollten auch einmal etwas wegwerfen dürfen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Niemand muss ein Leben lang dasselbe Kissen verwenden.»
Gleichzeitig weist Zeller darauf hin, dass es auch günstige Möglichkeiten für Reparaturen gibt. In «Repair-Cafés» arbeiten Freiwillige meist gratis oder gegen einen Beitrag in die Kaffeekasse. 2009 in Amsterdam entstanden, gibt es schweizweit mittlerweile gegen 200 dieser Flickwerkstätten. Dort werden zum Beispiel Ersatzteile aus dem 3-D-Drucker verwendet. Günstiger an Ersatzgeräte kämen wir laut Zeller auch, wenn wir vermehrt Gegenstände aus zweiter Hand kaufen oder ausleihen würden.
Anders als die Schweiz hat die EU bereits ein Recht auf Reparatur beschlossen. Das Europaparlament in Brüssel debattiert derzeit die Umsetzung. Hersteller könnten damit verpflichtet werden, während zehn Jahren Ersatzteile bereitzustellen. Frankreich kennt bereits einen «Reparatur-Index», der angibt, wie leicht sich zum Beispiel eine Waschmaschine reparieren lässt, wie Kuratorin Sara Zeller sagt. Solche Neuerungen könnten auch auf die Schweiz zukommen, denn der Nationalrat wird Ende Jahr eine Initiative behandeln, in der auch ein Passus zu Reparatur integriert wird. jow
«Klar bin ich für die Energiewende. Aber Windräder töten unzählige Vögel und schaden damit der Biodiversität.»
Keine Frage, Windenergieanlagen können Vögel auf mehrere Arten gefährden. Etwa, wenn sie deren Lebensraum zerstören oder in deren Flugbahn stehen. Eine Windenergieanlage soll laut dem Bundesamt für Energie pro Jahr den Tod von rund 20 Vögeln verursachen. Die Datenlage dazu ist allerdings dünn, Vogelschutzorganisationen sprechen von hohen Dunkelziffern.
Bei den 1000 vom Bund angestrebten Windrädern – zurzeit stehen rund 40 in der Schweiz – bedeutet das mindestens 20 000 tote Vögel pro Jahr. Klingt nach viel. Bis man sich ein paar andere Zahlen ansieht. Eine Million Vögel sterben laut einer Schätzung des Bundesamts für Energie jedes Jahr aufgrund des Verkehrs. Fünf Millionen wegen Glasfassaden. Und ganze 30 Millionen wegen Hauskatzen. In der Schweiz leben gemäss Verband Heimtiernahrung 1,8 Millionen Hauskatzen. Das heisst: Eine Katze weniger, und schon wäre ein ganzes Windrad kompensiert.
Es geht aber auch anders. Denn mehr Windräder müssen gar nicht mehr Vogelopfer nach sich ziehen. Forscher haben aufgezeigt, dass die Lage der Windenergieanlagen ausschlaggebend dafür ist, ob sie den Vögeln in die Quere kommen. Nur dort, wo Zugvögel Pausen einlegen, nach denen sie wieder steigen müssen, sind sie problematisch. Dieser Umstand wird bereits heute bei der Planung von Windenergieanlagen berücksichtigt. Und wer weiss: Vielleicht gibt es an den ungeeigneten Standorten Platz für ein paar Solarpanels. pef
«Wir brauchen nachhaltige Energie. Aber Solarenergie gehört nicht dazu. Für die Produktion von Solarpanels werden Unmengen an CO2 freigesetzt!»
Sonnenstrahlung in Energie umzuwandeln klingt nach der idealen Lösung im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Doch so einfach ist es nicht. Denn für die Produktion der Panels braucht es eben auch Rohstoffe und Energie. Stammt diese aus Kohlekraftwerken, wie es in China häufig der Fall ist, wird viel CO2 freigesetzt. Darunter leidet die Ökobilanz der Solarenergie.
«Wir gelangen nicht direkt von der fossilen Hölle in den solaren Himmel», sagte jüngst Jürg Grossen, GLP-Nationalrat und Präsident des Branchenverbands Swisssolar im «Beobachter». Momentan brauche es noch dreckige Energie, um saubere herzustellen.
Im Unterschied zu fossiler Energie ist die Bilanz von Solarpanels allerdings schon jetzt positiv. Einmal produziert, liefern sie mindestens 25 Jahre lang Strom. Kohle hingegen lässt sich nur einmal verbrennen. Nach zwei Jahren haben Solarpanels laut Swissolar mehr Energie produziert, als für ihre Produktion verbraucht wurde. Am Ende ihrer Lebensdauer sind es zwischen 15 und 20 Mal so viel. Das stellt den anfänglichen CO2-Ausstoss in den Schatten. Kommt hinzu, dass gemäss Swissolar über 75 Prozent des Materials in Solarpanels recycelt werden kann, Tendenz steigend. pef

«Ich bestelle ab und zu online — das wird ja wohl nicht so schlimm sein.»
Das lässt sich nicht so eindeutig sagen. «Es ist kompliziert», sagt Sacha Rufer, Redaktor beim Umweltnetz Schweiz und Geschäftsführer a. i. der Stiftung Umweltinformation Schweiz. «Je nach Lieferweg, persönlichem Einkaufsund Retourenverhalten sowie der Verpackung kann Onlineshopping ökologischer sein als der Einkauf im Laden.»
Das deutsche Umweltbundesamt ermittelte, dass bei einer Lieferung per Onlinedienst für eine Strecke von fünf Kilometern bis zu 400 Gramm CO2 anfallen. Fährt jemand dieselbe Strecke mit dem Auto, sind es bis 1100 Gramm CO2. Schlechter schneidet der Onlinehandel dagegen bei den Verpackungen ab. «Supermarktartikel verursachen bis 130 Gramm CO2, Onlinehandelsartikel dagegen bis zu 1000 Gramm CO2.»
Der ökologische Fussabdruck vergrössert sich insbesondere durch viele Retouren. Diese sind laut Rufer die Achillesferse des Onlineshoppings. Vor allem Kleider werden häufig retourniert; Studien der Universität Bamberg gehen davon aus, dass etwa jedes zweite Paket zurückgeschickt wird. In der Schweiz gab es im vergangenen Jahr laut Handelsverband fast 18 Millionen Retouren, eine Quote von mehr als 20 Prozent.
Zusätzlich seien sozioökonomische Aspekte zu berücksichtigen wie die Arbeitsbedingungen in den Verteilzentren, sagt Rufer. Beide Bereiche müssten nachhaltiger gestaltet werden: «Wir brauchen langlebigere Produkte und nachhaltige Lieferketten sowie einen bewussten Konsum.» Wer sicher sein will, möglichst ökologisch einzukaufen: am besten zu Fuss oder mit dem Fahrrad im Quartierladen oder der näheren Umgebung shoppen. jow



