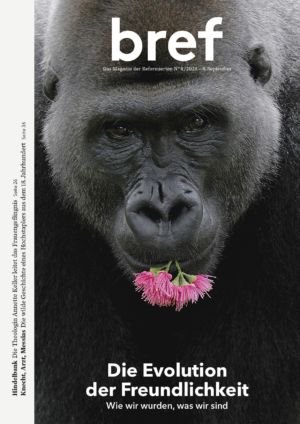Herr Sauer, Sie haben ein Buch über die Entwicklung der menschlichen Moral geschrieben. Darin heisst es: «Wir sind die Nachfahren der Freundlichsten.» Ein bemerkenswert kontraintuitiver Satz.
Das mag sein. Aber fragen wir uns doch, wie eine alternative Welt aussehen würde, in der Friedlichkeit und Freundlichkeit nicht so ausgeprägt sind wie bei uns. Diese Welten gibt es. Einerseits in der Vergangenheit: Vor 50, 500 oder 5000 Jahren war das Level an Aggression, Gewalt und Krieg höher als heute. Und andererseits bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen: Die sind so aggressiv und haben ihre Impulse so wenig unter Kontrolle – die kommen gar nicht bis zur Atombombe.
Die Atombombe als Beispiel für die Friedlichkeit der Menschen heranzuziehen — auch das klingt paradox.
Wir müssen uns bewusst machen, dass es ein hohes Mass an Kooperation braucht, um immer fortschrittlichere und damit auch effektivere Waffen herzustellen. Dazu sind Schimpansen und Gorillas nicht fähig. Sie leben auch nicht in grossen Gesellschaften, sondern in kleinen Gruppen, die sich zwar gegen innen grösstenteils friedlich verhalten, gegen aussen jedoch überhaupt nicht. Genauso wie die ersten Menschen. Wir müssen uns also fragen, was mit uns passiert ist, dass wir diese Kleinstrukturen verlassen und angefangen haben, immer grössere Kollektive zu bauen.
Hanno Sauer, Jahrgang 1983, ist Professor für Ethik und politische Philosophie an der Universität Utrecht. Er forscht zur Schnittstelle von Moralpsychologie, Neurowissenschaften und Ethik. Sauer lebt in Düsseldorf und ist Autor verschiedener Artikel und Bücher. «Moral» war 2023 für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert.
Sie greifen dazu auf das Konzept der «Selbstdomestizierung des Menschen» zurück. Was meinen Sie damit?
Bei domestizierten Tieren sehen wir bestimmte Eigenschaften: Ein Golden Retriever ist im Vergleich zu einem Wolf verspielter, friedlicher, loyaler. Er weist auch andere körperliche Merkmale auf, zum Beispiel kleinere Zähne oder eine verkürzte Schnauze. Das Konzept der Selbstdomestizierung besagt nun, dass wir Menschen nicht nur Tiere, sondern auch uns selbst gezähmt haben. Natürlich unbewusst und im Verlaufe vieler Jahrtausende. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Kooperation.
Inwiefern?
In dem Moment, als die Menschen lernten, miteinander zu kooperieren, konnten sie auch anfangen, sich gegen andere, nicht so kooperative Gruppenmitglieder zusammenzutun. Wenn also einer immer nur Ärger machte, vielleicht aggressiv war, seine Impulse nicht so gut kontrollieren konnte, dann konnte es passieren, dass er vom Rest der Gruppe einfach erledigt wurde. Wenn man das immer wieder macht und damit diese Individuen aus dem Genpool entfernt, kommt es zu einem «survival of the friendliest», einem Überleben der Freundlichsten. Damit setzt die Selbstdomestizierung ein.
«Ungleichheit kann nur entstehen, wenn es einen wirtschaftlichen Mehrertrag gibt.»
Ein evolutionsbiologischer Ansatz also.
Die Biologie setzt zumindest alles in Gang. Was danach kommt, sind verschiedene Selbstdomestizierungsschleifen, die vor allem kultureller Natur sind. Da geht es zum Beispiel um Strafen. Vorher konnte ich vielleicht meine eigene Position in der Gruppe verbessern, indem ich mich besonders rücksichtslos verhalten habe; aber in dem Moment, wo der Rest der Gruppe mein Verhalten verlässlich sanktioniert, kann ich mich anders entscheiden und mich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Auch das ist ein Domestizierungseffekt.
Sie haben die kleinen Gruppen von Menschenaffen mit unseren heutigen Grossgesellschaften verglichen. Was haben Gruppengrösse und Selbstdomestizierung miteinander zu tun?
Wir sehen, dass es immer dann neue Institutionen braucht, die das Zusammenleben regulieren, wenn der nächste Skalierungsschritt im Bau einer Gesellschaft ansteht, wenn also eine kritische Gruppengrösse erreicht ist. Das beginnt im Übrigen schon bei sehr kleinen Gruppen, mit 150 bis 200 Mitgliedern. Sie können das sehr leicht nachvollziehen, wenn Sie einmal versuchen, einen Campingtrip mit so vielen Leuten zu organisieren. Das wird nicht funktionieren, wenn es nicht irgendein institutionelles Gerüst gibt, das sagt, wohin die Reise geht, wer fischt, wer das Feuer macht und wer die Töpfe putzt. Gibt es diese Massnahmen nicht, fallen die Gruppen auseinander.
Bei einem solchen «Skalierungsschritt» seien soziale Ungleichheiten entstanden, die jahrtausendelang bestehen blieben, schreiben Sie in Ihrem Buch. Können Sie das erklären?
Zum einen wurden die Gesellschaften in der ersten Urbanisierungswelle rund 5000 Jahre v. Chr. so gross, dass es ohne die beschriebene Spezialisierung nicht mehr ging. Das ist der erste Punkt. Der zweite: Ungleichheit kann nur entstehen, wenn es einen wirtschaftlichen Mehrertrag gibt. Dieser Mehrertrag wiederum konnte in den frühen agrikulturellen Gesellschaften nur dort entstehen, wo die klimatischen Bedingungen entsprechend gut waren. Das war unter anderem im Zweistromland, im heutigen Irak, der Fall. Nun kam es, dass es einer kleinen Gruppe von Menschen gelang, sich einen unüblichen Anteil dieses Überschusses anzueignen und sich sozial über den Rest zu erheben.
Ohne Gegenwehr?
Auch hier spielt die Gruppengrösse eine Rolle: Was ich vorhin beschrieben habe – dass sich einige gegen ein unliebsames Mitglied der Gruppe zusammentun und dieses sanktionieren –, wurde in den ersten Grossgesellschaften schwierig zu koordinieren. Es gelang also nicht, sich gegen diese frühe Herrscherkaste zu emanzipieren.
Auffällig ist, dass fast in allen Kulturen und zu fast allen Zeiten Frauen schlechter gestellt sind als Männer. Wie ist es zu dieser Ungleichheit gekommen?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Die Wissenschaft nimmt heute an, dass es um die Geschlechtergleichheit in den ersten menschlichen Gesellschaften gar nicht so schlecht bestellt war. Zwar gab es auch damals schon eine Arbeitsteilung, die grösstenteils dadurch begründet war, dass Männer im Durchschnitt etwas grösser und stärker sind als Frauen. Interessanterweise hat das aber nicht zu einer Ungleichheit der Geschlechter geführt. Frauen waren also zum Beispiel auch an wichtigen Entscheidungen beteiligt. In dem Moment aber, wo sich der beschriebene Mehrertrag angefangen hat in den Händen weniger zu konzentrieren, entstanden echte patriarchale Strukturen.
Was meinen Sie mit «echt»?
Der Begriff Patriarchat wird oft unzutreffend verwendet. Es geht dabei nicht so sehr um eine Struktur, die Männer zuungunsten von Frauen bevorzugt. Sondern um eine Struktur, die einige wenige, in der Regel auch ältere und wohlhabendere Männer bevorzugt und die meisten anderen Männer und alle Frauen benachteiligt. Da die frühen Gesellschaften agrikulturell waren, wurden Fähigkeiten, die mit Körperkraft verbunden waren, ökonomisch prämiert. Damit waren Männer im Vorteil. In dem Moment, in dem andere Fähigkeiten in einer Gesellschaft wichtiger werden – Führungsstil, Wissen und so weiter –, nimmt die Ungleichheit der Geschlechter tendenziell ab.
Gibt es weitere Muster von Ungleichheit?
Es entstanden sogenannte Prestigehierarchien. Aufsteigen konnte entweder, wer Reichtum anhäufte und in der Folge militärische oder politische Macht erlangte. Oder wer besonders gut darin war, die Welt zu erklären. Oft ging das auch Hand in Hand. Denn in dem Moment, wo einige wenige unglaublich reich werden und die allermeisten anderen im Schweisse ihres Angesichts Sklavenarbeit verrichten, wollen die natürlich wissen: Hey, warum läuft denn das hier so?
«Selbst die Heroen unserer Kulturgeschichte wie Platon oder Aristoteles haben grösstenteils bestehende Ungleichheiten gerechtfertigt und nicht hinterfragt.»
Die Stunde der Philosophen und Theologen.
Ich weiss ja, dass die heutigen Intellektuellen ihre Funktion gerne darin sehen, besonders kritisch zu sein. Aber historisch war das überhaupt nicht der Normalfall. Selbst die Heroen unserer Kulturgeschichte wie Platon, Aristoteles oder Thomas von Aquin haben grösstenteils bestehende Ungleichheiten gerechtfertigt und nicht hinterfragt. Aristoteles’ «Politik» fängt schon damit an. Gleich auf der ersten Seite heisst es sinngemäss: Es muss Sklaven geben, sonst läuft hier gar nix. Selbst nach dem Beginn der Neuzeit hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis materielle, politische und soziale Ungleichheit zum Thema geworden ist.
Ein weiterer Punkt, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht, ist die Abwertung und gleichzeitige Ausnutzung von dem, was als fremd wahrgenommen wird. Sie räumen nun aber mit der Vorstellung auf, dass der Kolonialismus die Ursache dafür ist, dass die westlichen Länder reich sind und die Länder im globalen Süden arm.
Es gibt zwei Mechanismen, die diesen Irrtum verführerisch machen. Erstens: Intuitiv fällt es uns am leichtesten, Wirtschaft als Nullsummenspiel zu sehen.
Was heisst das konkret?
Ein Nullsummenspiel ist ein Spiel, bei dem die Gewinne des einen die Verluste des anderen sind. Oder anders gesagt: Wenn wir sehen, hier ist jemand reich geworden, dann fragen wir instinktiv, okay, wem hat der das weggenommen?
Und das ist falsch?
Für die moderne Wirtschaft, ja. Zu Zeiten des Imperialismus wurden gar nicht so sehr Ressourcen von einem Ort an den anderen verlegt; sondern es sind neue Institutionen entstanden, die zu einer Vergrösserung des Kuchens geführt haben. Technologische Innovationen, staatliche Förderung, ganz neue Konzepte des wirtschaftlichen Handels, Märkte, wissenschaftliches Wissen – das alles hat zu einem echtem Wirtschaftswachstum geführt, das die Nullsummen-Theorie nicht erklären kann.
Und der zweite Irrtum?
Es ist ein bisschen wie beim Patriarchat: Es war gar keine Verschwörung der Engländer gegen die Inder oder der Franzosen gegen die Nordafrikaner, mit dem Ziel, erstere reich zu machen und letztere arm. Sondern es gab so etwas wie eine Verschwörung der Eliten in beiden Regionen gegen die arme Bevölkerung in beiden Regionen. Kolonialismus ist gar kein wirtschaftlich solides Konzept. Er hat auch 99 Prozent der englischen Bevölkerung nicht gedient, riesige Ressourcen sind dort hineingeflossen, die besser anders genutzt worden wären. Das ist aber eigentlich eine gute Nachricht.
Ach ja?
Mein Punkt ist, dass Kolonialismus nicht nur moralisch und politisch eine katastrophale Idee war, sondern auch noch ökonomischer Blödsinn. Gleiches gilt auch für andere Formen der Ausbeutung und Misshandlung wie zum Beispiel Sklaverei. Das sieht man etwa daran, dass die Südstaaten der USA immer ärmer waren als die Nordstaaten, die ohne Sklaverei auskamen. Wer dagegen sagt, der Westen sei durch Kolonialismus reich geworden, verteidigt das Konzept dadurch fast ein wenig.
Dennoch läuft Ihre Erklärung dem zuwider, was wir intuitiv als gerecht empfinden — einem Bedürfnis, dass die ehemals kolonialistischen Staaten Wiedergutmachung leisten sollen für das, was sie getan haben.
Das kann man ja immer noch tun – und soll es auch. Ich will Kolonialismus nicht rechtfertigen, im Gegenteil. Die Kolonialisten haben die Institutionen in den betroffenen Ländern zerstört, willkürliche Grenzen gezogen und grausamste Verbrechen begangen. Dieser Punkt bleibt total bestehen.
Wenn es nicht der Kolonialismus war: Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Reichtum global so unterschiedlich verteilt ist?
Die aktuell am besten bestätigte Theorie ist die der Seltsamkeit, auf englisch Weirdness. Das steht für western, educated, industrialized, rich democracies. Kern dieser Theorie ist, dass die modernen Gesellschaften sich ausbilden und ihren Reichtum erwerben konnten, weil man im Früh- und Hochmittelalter angefangen hat, Eheschliessungen zwischen engen Verwandten zu verbieten.
«Die katholische Kirche, die auf Ritualen basiert, auf Hierarchie und Autorität, wurde weniger attraktiv.»
Das müssen Sie erklären.
Damit wurden die Clanstrukturen Europas aufgebrochen und die Familien als Grundprinzip gesellschaftlicher Organisation abgelöst. Es entstanden Institutionen, die nicht mehr darauf basierten, wer mit wem verwandt oder verschwägert ist, sondern auf freiwilliger Mitgliedschaft – Städte, Klöster, Universitäten. In der Folge kam es zu einer rapiden Expansion von technologischem Fortschritt und wissenschaftlichem Wissen, was unseren Denkstil und unsere Psychologie verändert hat – auch das wieder eine Art kulturelle Evolution. Erst dadurch wurde der moderne Reichtum in den europäischen Nationen und ihren Exportgesellschaften wie Australien und Amerika möglich.
Was hat diese Entwicklung ausgelöst?
Die Verbote gehen auf die sogenannt westliche Kirche zurück, also das, was wir heute als katholische Kirche kennen. Ironischerweise hat sie sich damit ein Stückweit selbst geschadet.
Inwiefern?
Seltsame Gesellschaften sind viel stärker individualistisch geprägt, was sich auch auf die Religiosität auswirkt. Seltsamkeit begünstigte damit die Entstehung des Protestantismus. Dessen Kernidee ist ja gerade, dass es nicht auf die Gruppe ankommt, sondern auf den einzelnen Gläubigen und seinen individuellen Zugang zur Schrift und die persönliche Beziehung zur Gottheit. Die katholische Kirche dagegen, die auf Ritualen basiert, auf Hierarchie und Autorität, wurde weniger attraktiv.
Werfen wir einen Blick in die jüngere Vergangenheit. Gerade im 20. Jahrhundert kam es zu einigen der schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Wie passt das in Ihre Fortschrittsgeschichte?
Fortschritt ist nun mal nicht linear, es gibt immer wieder Episoden der Regression. Manchmal ist diese Regression vielleicht nur vorübergehend und nicht so dramatisch; aber manchmal, wie beim Zweiten Weltkrieg, beim Holocaust oder beim Stalinismus, ist sie katastrophal. Wir sehen leider historisch, dass jede Gesellschaftsform die Art von Grausamkeit begeht, zu der sie technisch fähig ist. Das werden wir nicht mal eben so los. Einer der grossen Lerneffekte des 20. Jahrhunderts ist aber, dass wir genau das begriffen haben: Dass eben kein Level an Aufklärung, keine Tradition von Beethoven und Bach und Goethe und Schiller, verlässlich verhindern kann, dass so etwas passiert.
Welche Konsequenzen hat das?
Wir haben verstanden, dass wir ganz neue Institutionen bauen müssen, die diese Art von Rückfall in Gewalt und Grausamkeit, Krieg und Konflikt noch etwas besser eingrenzen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Stichworte sind Uno, Menschenrechtskonvention oder internationale Kooperation, die es in der Form vorher nicht gegeben hat. Wir leben heute in einem Europa, in dem es zwischen zwei Dutzend Ländern offene Grenzen und eine gemeinsame Währung gibt. In vielen Ländern leben schon zwei oder drei Generationen, die ohne das Risiko eines Krieges aufgewachsen sind. Das wäre vor hundert Jahren undenkbar gewesen.
So richtig tröstlich ist das nicht: Wir sehen ja zurzeit im Ukraine-Konflikt, dass auch diese Institutionen Grausamkeit und Krieg nicht verhindern können.
Aber gerade in der Reaktion auf die russischen Kriegsverbrechen sehe ich etwas Positives: Es waren alle überrascht und schockiert. Alle sagten, damit hätten sie nicht gerechnet. Noch vor hundert Jahren hätten die Menschen gesagt, doch, damit habe ich jeden Tag gerechnet!
«Es gibt keine Dynamik zunehmender Extremisierung, sondern eher einer zunehmenden Sortierung.»
Am Ende Ihres Buches schreiben Sie über die Polarisierung der Gesellschaft: «Wir sind gar nicht unterschiedlicher Meinung. Wir hassen uns einfach nur.» Ist das eine gute Nachricht?
So war es zumindest gemeint. Es ist nämlich gar nicht so, dass die Mehrheit der Menschen sehr durchdachte, konkrete und stabile Konzepte hätte, die von denen anderer Menschen abweichen. Grundsätzlich sind unsere Vorstellungen einer idealen Welt sehr ähnlich. Was wir als Polarisierung wahrnehmen, ist grösstenteils ein affektives Phänomen, bei dem uns unser altes Stammesdenken in die Quere kommt: Wir denken intuitiv, wir sind so, und die anderen sind anders. Wir sind urban und gebildet, und die anderen sind dumm und hinterwäldlerisch. Es geht also mehr um eine emotionale Aversion gegenüber den anderen Stämmen, also den anderen politischen Gruppen, als um eine echte Diskrepanz zwischen Ideologien. Hierin steckt Vermittlungspotenzial.
Halten Sie denn die viel zitierte These, dass die Polarisierung zunehme, für falsch?
Die empirischen Daten weisen darauf hin, dass sie zumindest eine Übertreibung ist. Es gibt keine Dynamik zunehmender Extremisierung, sondern eher einer zunehmenden Sortierung. Will heissen: Die Lager sind klarer geworden, nicht extremer. Wir wissen also einfach besser, wofür zum Beispiel so jemand wie ich – jung, gebildet, urban – steht. Das wirkt auf uns wie Polarisierung. Hinzu kommt, dass die sozialen Medien die extremsten Stimmen verstärken. Dadurch haben wir das Gefühl, es gebe nur noch extreme Positionen. Aber in Wirklichkeit gibt es eine grosse Menge von Menschen in der Mitte, deren politische Haltung sehr viel moderater und kompromissfähiger ist, als wir das vielleicht denken.
Sie bleiben also trotz allem optimistisch, was die Entwicklung der Menschen — und ihrer Moral — betrifft.
Zumindest optimistischer als die meisten. Ich will nicht sagen, dass alles eitel Sonnenschein ist, aber die empirischen Daten zeigen, dass es grosse Gruppen von Menschen gibt, die sich eigentlich miteinander verständigen könnten.
Hanno Sauer: «Moral. Die Erfindung von Gut und Böse.» Piper, München 2023; 400 Seiten; 31.20 Franken.