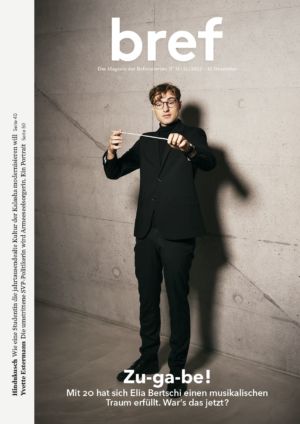Mit einer schwarzen Fellmütze auf dem Kopf erscheint Yvette Estermann zum Schwertkampf. Den imposanten Zweihänder legt sie auf die kleine Steinmauer vor dem Museggschulhaus in Luzern. In der Turnhalle der Schule üben sich Mittelalter- und Kampfsportfans in der Kunst des historischen Fechtens. Sie befinde sich ganz auf den Spuren von Zwingli, sagt Estermann und lacht. Damit die historischen Fechterinnen aber nicht dasselbe Schicksal ereilt – der Reformator starb 1531 auf dem Schlachtfeld –, sind ihre Waffen stumpf.
Ob mit dem Schwert oder mit politischen Vorstössen: Yvette Estermann weiss, wie man kämpft. 16 Jahre lang sass sie für die Luzerner SVP im Nationalrat. Trotz dieser langen Amtszeit ist es ihr gelungen, bei der Ankündigung ihres Rücktritts im Sommer 2023 alle zu überraschen: Sie werde reformierte Armeeseelsorgerin, liess sie verlauten. Schon im kommenden Januar tauscht Estermann ihr Schwert gegen eine Pistole, die zur Ausrüstung gehört. Dass die 56jährige noch während der letzten Legislatur ein Theologiestudium in Angriff genommen und sich auf eine Stelle als Armeeseelsorgerin beworben hatte, war selbst vielen ihrer Nationalratskollegen entgangen.
Um Armeeseelsorgerin zu werden, hat Estermann einiges auf sich genommen. Vor der eigentlichen Ausbildung musste sie ein militärisches Training absolvieren. Das hiess unter anderem: drei Wochen lang Sport und Drill vor dem Frühstück um 6 Uhr. «Für mich war es wie Aktiv-Urlaub», sagt Estermann. Sie habe aber schon gemerkt, dass sie nicht mehr zwanzig Jahre alt sei.
Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung
Nach dem Aufwärmen kreuzt Estermann die Klingen mit einem jungen Mann. Schritt für Schritt und mit konzentrierter Miene bewegt sie sich auf ihn zu. Langsam weicht der Mann zurück. Der Trainer gibt Anweisungen zur Beinarbeit und zur Haltung mit der Waffe. Wichtig sei, die richtige Distanz zu wahren, mahnt er. Wer der anderen Person zu nah komme, setze sich dem Risiko eines Hiebes, Stiches oder Schnittes aus. Doch das weiss Estermann zu verhindern.
Die ČSSR brauchte Ärztinnen und keine Theologinnen. Also studierte Estermann in Bratislava Medizin.
Viel Zeit blieb ihr in den letzten Jahren nicht für das Training. Das politische Mandat sorgte für eine volle Agenda. Nun freue sie sich auf den ersten freien Advent seit Jahren, sagt Estermann. Doch lange dauert die Pause nicht. Die Uniform und der Master in Theologie warten. Geht alles gut, möchte sie ab 2027 als Pfarrerin tätig sein. «In meiner Familie ist es nicht üblich, mit dem Arbeiten aufzuhören», sagt Estermann.
Geboren und aufgewachsen ist sie als Iveta in einem kleinen Dorf in der damaligen Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, ČSSR. Dort sei sie gleichzeitig geborgen und frei gewesen. «Es gab kaum Autos oder Vorschriften», erinnert sie sich. Sie musste sich nur daran halten, bei Sonnenuntergang zu Hause zu sein.
Wer in der ČSSR an Gott glaubte und diesen Glauben lebte, befand sich in einer Grauzone. Die sozialistische Regierung duldete die Kirche zwar, aber sah es nicht gerne, wenn Kinder den Religionsunterricht besuchten. Zwar hätten die meisten daran teilgenommen, sagt Estermann, doch die Eltern hätten deswegen den Druck des Regimes zu spüren bekommen.

Estermanns Vater war evangelisch, ihre Mutter katholisch. In der Bibliothek der Familie standen religiöse Bücher und verschiedene Bibelausgaben. «Ich ärgerte mich darüber, wenn sich meine Lieblingsstellen je nach Ausgabe unterschieden», erinnert sich Estermann. Deshalb wünschte sie sich schon früh, Theologie zu studieren und Hebräisch und Altgriechisch zu lernen, um die Texte im Original lesen zu können.
Doch eine freie Wahl des Studiums gab es damals nicht. Die ČSSR brauchte Ärztinnen und keine Theologinnen. Also studierte Estermann in Bratislava Medizin. Das Interesse an der Theologie habe sie jedoch nie verloren. Bis sie dieses Studium tatsächlich begann, sollten noch einige Jahrzehnte vergehen. Erst als Bundesrat Ueli Maurer an einer Fraktionssitzung über den Mangel an Armeeseelsorgern sprach, tauchte der langersehnte Wunsch wieder auf (siehe Kasten).
Zurzeit zählt die Armee 174 Seelsorgerinnen und Seelsorger verschiedener Konfessionen, wie Samuel Schmid, Chef der Armeeseelsorge erklärt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach ihren Dienstleistungen während der Corona-Pandemie wurde die Anzahl der Milizstellen im Jahr 2023 auf 242 erhöht. In wenigen Jahren sollten diese besetzt sein, wie Schmid sagt.
Interessentinnen mit einer erfolgreichen Bewerbung müssen ein Assessment und eine militärische Grundausbildung durchlaufen, falls sie diese nicht schon besitzen. Zudem brauchen sie die Empfehlung einer Kirche oder religiösen Gemeinschaft, die Partnerin der Armeeseelsorge ist.
Schmid ist bei jedem Assessment persönlich anwesend, wie er erklärt. Hinter Yvette Estermann stehe er voll und ganz. Ihre Kandidatur sei wie jede andere auch behandelt worden. Zudem seien in der Milizarmee die verschiedensten politischen, religiösen und gesellschaftlichen Ansichten vertreten. Schmid betont, dass die seelsorgliche Betreuung der Armeeangehörigen von allen Armeeseelsorgerinnen gleichermassen gewährleistet werde.
Als sie schliesslich vor der Entscheidung stand, für eine weitere Amtszeit zu kandieren, habe sie sich gesagt: Jetzt oder nie.
Bei den Wählern beliebt, im Rat isoliert
Juli 2023: Estermann reist mit dem Ortsbus an. In Luzern führte die Ärztin und Homöopathin bis 2005 eine Praxis, doch ihr Zuhause liegt in Kriens vor den Toren der Stadt. Auf dem Land habe sie sich schon immer wohler gefühlt, sagt sie, während sie im geblümten Kleid über die Seebrücke spaziert.
Sie zog in den 90er Jahren in die Innerschweiz zu ihrem Ehemann. Kennengelernt hatten sie sich in Wien, wo Estermann manchmal für die Prüfungen an der Universität lernte. Zu diesem Zeitpunkt war die ČSSR bereits Geschichte.
«Gefühlt haben wir in all den Jahren keine halbe Stunde miteinander gesprochen. Sie ist immer ihre Wege gegangen.» Ida Glanzmann-Hunkeler über Estermann
Im Kanton Luzern änderte Estermann ihren Vornamen von Iveta zu Yvette. Schon bald zog es sie in die Politik. Sie galt als sympathisch, volksnah und gut integriert. 2007 wurde sie mit dem Slogan «erfrischend anders» auf Anhieb und mit einem Glanzresultat für die Luzerner SVP in den Nationalrat gewählt.
Doch dort blieb sie isoliert, wie Gespräche mit Ratskolleginnen und -kollegen nahelegen. Die Luzerner Mitte-Politikerin Ida Glanzmann-Hunkeler zum Beispiel rutschte ein Jahr vor Estermanns Wahl in den Nationalrat nach und beendete ihre Politkarriere zur gleichen Zeit wie die Kollegin aus der SVP. Auf Estermann angesprochen zögert sie zuerst. Doch dann sagt sie: «Gefühlt haben wir in all den Jahren keine halbe Stunde miteinander gesprochen.» Dabei pflege sie Kontakte in allen politischen Lagern, betont die ehemalige Präsidentin der CVP-Frauen und Vizepräsidentin der CVP Schweiz.
Glanzmann-Hunkeler beschreibt Estermann als Einzelgängerin. «Sie ist immer ihre Wege gegangen.» An gesellschaftlichen Anlässen der Bundesversammlung oder im Kanton Luzern sei sie selten aufgetaucht – und wenn, dann nur kurz. Eine Weile sassen sie zusammen in der Geschäftsprüfungskommission. Estermann sei häufig zu spät gekommen und zu früh gegangen.
Politisch gab es zudem kaum Gemeinsamkeiten. Wie die Mehrheit des Nationalrats verspürte die Mitte-Politikerin keine Lust, zu Sessionsbeginn jeweils eine Strophe der Schweizer Hymne zu singen, wie Estermann es einmal mit einem Vorstoss gefordert hatte.
Schon an ihrem ersten Tag in Bern trug Estermann Luzerner Sonntagstracht und drückte damit ihren Nationalstolz aus. Ihren grössten – und einzigen – politischen Erfolg erzielte sie in der Halbzeit ihres Mandats: die permanente Beflaggung des Bundeshauses. Medien bezeichneten sie dafür auch schon als «Nischenpolitikerin mit patriotischem Flair».
Lob erhält sie von Parteikollege und Nationalrat Franz Grüter. «Yvette Estermann ist sehr engagiert», sagt der Luzerner. Sie habe sich immer für die Unabhängigkeit der Schweiz eingesetzt und eine rechtskonservative Haltung vertreten. Allerdings habe Estermann mit ihrer Themenauswahl wohl immer eine andere Wählerschaft angesprochen als er. Damit streift der IT-Unternehmer den wichtigsten Aspekt für Estermanns politische Isolation.
Während ihre patriotischen Anliegen noch als Symbolpolitik durchgingen, stiessen ihre gesundheitspolitischen Positionen auf Ablehnung. So kämpfte Estermann etwa an vorderster Front für zwei Initiativen, die Abtreibungen erschweren sollten. Beide Anliegen scheiterten noch in der Sammelphase 2023. «Diese Initiativen waren für mich ein No-Go», sagt alt Nationalrätin Glanzmann-Hunkeler.
In ihrer letzten Legislatur fiel die Ärztin und Homöopathin vor allem als vehemente Gegnerin der Covid-Massnahmen auf. Sie engagierte sich im Komitee, das die Stopp-Impfpflicht-Initiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» einreichte. Die 2020 gegründete «Freiheitliche Bewegung Schweiz» hatte sie lanciert. Estermann unterschrieb an dritter Stelle – direkt vor Komiker Marco Rima.
Den Bundesrat beschäftigte Estermann mit unzähligen Vorstössen und Anfragen zu den Massnahmen während der Pandemie. Manche davon erschienen kurios: Etwa als sie wissen wollte, ob der indirekte Covid-Impfzwang die Religionsfreiheit verletze. Schliesslich würden die Corona-Impfstoffe zum Teil mit Organen von abgetriebenen Föten entwickelt. Die Anfrage klingt nach Verschwörungstheorie, der Bundesrat antwortete knapp: Weder bestehe ein Impfzwang, noch würden für die Produktion der Impfstoffe menschliche Zellen verwendet.
Glaubt sie selbst solchen Behauptungen? Dumme Fragen gebe es nicht, sagt Estermann. Wer bei ihr mit einer Frage anrufe, habe das Recht auf eine Antwort des Bundesrats. Estermann als das ungefilterte Sprachrohr einiger Wählerinnen und Wähler? Es sind solche Aussagen, die sie als Person schwer greifbar machen.
Nicht erst in der Corona-Pandemie fiel Estermanns Nähe zu Verschwörungstheorien auf. Mehrmals arbeitete sie mit dem Alpenparlament zusammen. Die Organisation sammelte Unterschriften für Initiativen, die Estermann mitlanciert hatte. Die Website der Gruppierung lese sich wie ein «Best-of» von Verschwörungstheorien, schrieb SRF vor einigen Jahren. Von Chemtrails und einer mutmasslichen CO2-Lüge fabuliert die Vereinigung und davon, dass Juden die Welt kontrollierten. Letzteres brachte dem Alpenparlament 2019 eine Anzeige des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds ein.
Estermann sah in all dem kein Problem: Sie beurteile Menschen nach ihrer Arbeit, nicht nach ihren Ansichten, sagte sie damals zu den Medien. 2019 gelang ihr die Wiederwahl nur knapp. Wenige Stimmen trennten sie von einer parteiinternen Konkurrentin.
Von der Politikerin zur Seelsorgerin
Estermanns Ansichten sind umstritten. Und sie sind öffentlich bekannt. Wird es ihr gelingen, zwischen ihrer Rolle als Politikerin und der als Theologin zu unterscheiden?
Zumindest im Hörsaal scheint das der Fall zu sein. Mitstudierende berichten, dass sie erst während der Corona-Pandemie vom politischen Engagement Estermanns erfahren hätten. Damals habe Estermann häufig aus dem Nationalratssaal an den Online-Vorlesungen teilgenommen – im Gesicht eine Maske mit dem Schäfchen-Motiv der SVP.
«Ich stehe zu dem, was ich in meiner politischen Karriere gesagt habe», sagt Estermann. Dazu gehört das Ablehnen der Abtreibung ebenso wie ihr Nein zur Ehe für alle.
Andreas Köhler-Andereggen beschäftigt sich von Berufs wegen mit Fragen des Rollenbilds: Er ist Leiter der Koordinationsstelle für praktikumsbezogene theologische Ausbildung der Universität Bern. Im Pfarrberuf, meint er, seien Amt und Person miteinander zu bedenken. «Ich zeige mich als Mensch und als Theologe.» Es brauche Fingerspitzengefühl und Erfahrung, um sich angemessen zu verhalten.
Doch wie weit kann man sich in einem persönlichen Kontakt zurücknehmen? Keine leichte Aufgabe, wie Köhler ausführt: «Meine Haltung – nicht nur politisch –, mein Menschen-, Glaubens- und Gottesbild, meine Biografie, das ist ja alles immer da und gehört zu mir.» Pfarrer müssten das stets bedenken, und: «Sie müssen lernen, Person und Amt ins richtige Verhältnis zu setzen.» Das alles sei Teil der Ausbildung.
Yvette Estermann hat sich dazu bereits Gedanken gemacht. «Meine politischen Tätigkeiten enden mit dem Abschied aus dem Nationalrat», sagt sie. Ihre Ansichten hingegen bleiben dieselben: «Ich stehe zu dem, was ich in meiner politischen Karriere gesagt habe.» Dazu gehört das Ablehnen der Abtreibung ebenso wie ihr Nein zur gleichgeschlechtlichen Ehe.
Damit vertritt die abtretende SVP-Politikerin andere Positionen als die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, die ihren Mitgliedkirchen 2018 die Öffnung der Ehe empfahl. Gleichzeitig gilt in den meisten Kantonalkirchen die Gewissensfreiheit in Sachen Ehe für alle: Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen Trauungen ablehnen, wenn sie diese mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. So weit würde Estermann aber nicht gehen. Sie akzeptiere Volksentscheide, sagt sie.
Grundsätzlich lassen die kirchenrechtlichen Bestimmungen den Pfarrerinnen viel Raum für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Diesen Raum kann Yvette Estermann nach eigener Einschätzung gut füllen: «Mein grosser Rucksack kann anderen helfen.» Sie habe Erfahrung und Wissen aus der Politik, der Medizin und ihrer Tätigkeit als Life-Coach und Homöopathin. «Dadurch kann ich eine bessere Pfarrerin sein», erklärt sie. Sie setzt auf ihre praktische Erfahrung, um «fundierte Hilfe» zu leisten. Und nicht auf «etwas Studiertes».

Einen solchen Rucksack könnte man auch leicht als Wundertüte ansehen. Doch die SVP-Politikerin ist überzeugt, dass die Menschen einer Kirchgemeinde wüssten, was sie an ihr hätten. Als Nationalrätin sei sie nahe an der Basis gewesen – «man konnte mich immer anrufen» – und aktiv in vielen Vereinen. «Wenn mich eine Kirchgemeinde wählen würde», sagt sie, «bekäme sie diese Yvette Estermann. Wenn man mich nimmt, nimmt man das ganze Paket.»
Was es bedeutet, das «ganze Paket Estermann» zu bekommen, kann vielleicht Samuel Burger einschätzen. Er ist Pfarrer in Konolfingen BE. Seit rund zwanzig Jahren arbeitet er auch als Ausbildungspfarrer und begleitet Studentinnen und Studenten beim Berufseinstieg. Im August und September 2020 hielt sich Yvette Estermann für ein Praktikum fünf Wochen lang in Konolfingen auf. Die Krienserin bezeichnet Burger als ein gutes Vorbild – und einen begabten Musiker. Der Pfarrer hat eine Band, in der er Gitarre spielt und singt, Yvette Estermann gehörte zur parteiübergreifenden «Bundeshausband» – als Backgroundsängerin.
In den fünf Wochen Konolfingen erlebte die Studentin Estermann von der Taufe bis zur Sitzung mit dem Kirchgemeinderat alles. Manches konnte sie auch selber mitgestalten. «Es war viel los in dieser Zeit», erzählt Burger, «sie hatte Glück.»
Als Estermann ihn anfragte, war Burger erstaunt. Er hatte schon von ihr gehört – und nicht nur Positives. Deshalb war er skeptisch und führte mit ihr zuerst ein Vorgespräch. Dieses Treffen stimmte ihn um, er sagte der prominenten Praktikantin zu.
Eine leise Kritik schwingt dennoch mit. Burger versucht es so zu formulieren: «Sie hat ein gutes Gespür dafür, was die Leute hören möchten.»
Die Arbeit mit Yvette Estermann sei «eigentlich sehr gut» verlaufen. Sie sei äusserst aufmerksam und anpassungsfähig gewesen. Gleichzeitig habe sie gewusst, was sie wolle. Zu den Menschen der Kirchgemeinde Konolfingen hatte sie schnell einen guten Draht. Burger erhielt nur gute Rückmeldungen von Tauf-, Trau- und Trauerfamilien. Auch die Konfirmandengruppe respektierte die Praktikantin aus der Innerschweiz.
Gab es Vorbehalte gegenüber Estermann, dann gründeten sie in ihrem politischen Leben. Doch in Konolfingen trat sie als Theologiestudentin auf. Burger sagt: «Wer sie nicht schon kannte, nahm sie nicht als Politikerin wahr.» Zwar habe sich manch einer in der Gemeinde einen Spruch nicht verkneifen können. «Aber», sagt Burger, «auch wenn einmal SVP-kritische Bemerkungen fielen, steckte sie das weg.» Manchmal lachte sie sogar darüber, was den Pfarrer sehr erstaunte.
Jeweils nach dem Praktikum verfasst Ausbildungspfarrer Burger einen Bericht über die Studentinnen und Studenten, die bei ihm waren. Über Yvette Estermann schrieb er, dass ihr die Menschen wichtiger seien als die dogmatische Korrektheit der theologischen Lehre. Er schätzt sie als gute Seelsorgerin ein, die zuhören und Halt vermitteln kann. Was er von Estermann nicht erwartet, sind feurige Predigten oder innovative theologische Entwürfe. Dafür hat sie seiner Meinung nach andere Stärken: Sie werde in einer Kirchgemeinde eine vermittelnde Rolle einnehmen, könne andere Meinungen akzeptieren und müsse nicht immer recht haben.
Eine leise Kritik schwingt dennoch mit. Burger versucht es so zu formulieren: «Sie hat ein gutes Gespür dafür, was die Leute hören möchten.» Es sei dadurch nicht gleich greifbar, wen man vor sich habe und was sie wirklich denke.
Polarisieren mit Charme
Nach einem kurzen Spaziergang durch Luzern hat Estermann in einem Gartenrestaurant Platz genommen. Dort gibt sie bereitwillig Auskunft zu ihrer Person. Sie ist eine aufmerksame Gesprächspartnerin und um keine Antwort verlegen – auch wenn die Aussagen polarisieren.
Lächelnd erklärt sie beispielsweise, weshalb sie im Krieg Russlands gegen die Ukraine Verständnis für den russischen Präsidenten Putin hat: «Die ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts sollten neutral bleiben, doch viele sind der Nato beigetreten. Wenn Sie einen friedlichen Menschen zu lange reizen, rastet er aus.» Oder wenn sie behauptet, in der Schweiz herrsche eine versteckte Zensur der Medien: «Es werden gewisse Meinungen bevorzugt, das sorgt für Unruhe in der Gesellschaft. Es besteht die Gefahr eines Wurzelbrandes.»
Fragt man danach, was die Schweiz im Kampf gegen den Klimawandel beitragen könne, sagt sie milde lächelnd: «Wenn die Menschen sich unsere Landeshymne anhören und danach handeln würden, bräuchte es kein CO2-Gesetz.» Denn: Wer Gott und das Vaterland ehre, würde niemals freiwillig etwas tun, das der Natur schade. Hakt man nach, ob die SVP unter anderem bei diesen Themen nicht bewusst die Unzufriedenheit schüre, weicht sie aus; sagt lachend, das müsse man den Generalsekretär der Partei fragen. Und: «Ich kann nicht für die ganze SVP sprechen.»
In die Partei trat sie damals ein, weil die SVP aus ihrer Sicht als einzige Missstände klar benannte. Für sie hielt Estermann den Kopf hin, wurde angefeindet, etwa beim Abstimmungs- und Wahlkampf auf der Strasse. «Klar tut es weh, beschimpft zu werden», sagt sie. «Aber ich konnte es durchstehen, weil das, was ich tat, wichtig für das Land und die Bevölkerung war.» Klingt nach Parteisoldatin, doch hier und da blitzt auf, dass sie zumindest nicht uneingeschränkt der Parteilinie folgte.
Als beispielsweise die SVP-Exponenten sich medienwirksam über muslimische Feldgebete in der Schweizer Armee aufregten, sagte die angehende Armeeseelsorgerin ihren Parteikollegen, sie müssten sich besser informieren. Zudem meint Estermann: «Unsere Gesellschaft ist vielfältig, das sollte die Armee widerspiegeln.» Doch ein persönliches Statement wollte sie damals nicht abgegeben.
Die Bedienung serviert an den Nebentischen die ersten Mittagsmenus. Estermann lehnt sich im Stuhl zurück. Sie scheint den Rollenwechsel bereits vollzogen zu haben. Sie sagt: «Politische Statements wird niemand mehr von mir hören. Man muss nicht überall seinen Senf dazugeben.»
Dann klingelt ihr Telefon – ihr Mann. Wann sie nach Hause komme, fragt er. Sie stellt ihm eine rasche Heimkehr ebenso in Aussicht wie ein Stück Wähe vom Lieblingsbäcker. Dann verabschiedet sie sich schnell, aber herzlich, und geht zügig in Richtung Bushaltestelle. Nach wenigen Schritten hält ein Mann sie auf, der Estermann als Politikerin erkannt hat. Sie geben sich die Hand, sprechen angeregt miteinander und verabschieden sich schliesslich rechtzeitig, damit Yvette Estermann noch den Bus erwischt.