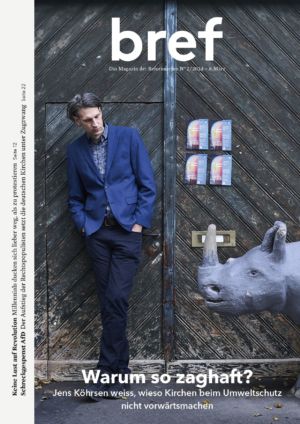Einmal, erzählt Christian Mende, habe er am Kirchturm gehangen. Ein Banner, drei mal acht Meter gross, hatte sich im Sturm gelockert. «Zu Frieden seid ihr berufen» stand da; der Ukraine-Krieg hatte gerade begonnen. Mende schnappte sich Seil und Klettergurt, stieg auf den Turm und seilte sich ab. Aus 25 Metern, im Dunkeln, allein. Dann hörte er die Sprechchöre, sah die Fackeln, die Fahnen. Mende erstarrte. Das Ende seines Seils baumelte über dem Boden.
Und unter ihm zog die Greizer Montagsdemo vorbei, wo stadtbekannte Nazis mitlaufen.
Wenn die das Seil anfackeln, ich komm’ nicht mehr weg, dachte er. Mende knipste die Stirnlampe aus, krallte sich an die Kirchturmbrüstung. Nur keinen Mucks. So erzählt er es heute, an einem Nachmittag Anfang Dezember. «Eigentlich hätte ich das Banner beleuchten und schreien müssen», sagt er. Er lächelt wie jemand, der weiss, dass sonstwas hätte passieren können.
Im Greizer Kirchgemeindehaus, gegenüber der Stadtkirche St. Marien, sitzt Mende neben Regalen mit Knete und Krepppapier. Er wischt auf dem Handy herum, bis er gefunden hat, was er sucht, sein Whatsapp-Profilbild: Bart Simpson. «Mit Nazis geht man nicht spazieren», schreibt der an die Tafel. Mehrere Konfirmanden-Eltern, die selber bei den Demos mitlaufen oder zumindest Sympathien dafür haben, hätten ihn deswegen kritisiert.

Gemeindepädagoge Christian Mende greift gleich selber zur Kletterausrüstung, wenn es am Kirchturm ein Banner zu befestigen gilt.
Mende trägt Jeans und Kapuzenpulli. Er ist 41, Gemeindepädagoge mit Zusatzausbildung Erlebnispädagogik, Schwerpunkt Klettern, Höhlen, Wildwasser. Im Flur vor seinem Büro lagern Seile und Karabiner, an der Wand: Bilder vom Demokratiebus. Drei Jahre fuhr der Linienbus durch den Landkreis, beklebt mit Statements zu Respekt und Toleranz; #vielfalt stand über der Tür. 2019 erhielt der Bus den Demokratiepreis des deutschen Bundeslandes Thüringen. Mende hatte die Idee gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern umgesetzt. In Greiz leitet er die Junge Gemeinde.
Greiz liegt im Osten Thüringens, 20 000 Menschen leben hier. Es gibt zwei Schlösser, die Altstadt ist eng und kopfsteingepflastert, im Stadtrat dominiert die Christlich Demokratische Union (CDU). Für junge Leute gibt es wenig, ein Kino, einen Sportplatz, drumherum Dörfer, Wald.
Ende Dezember war auf X, ehemals Twitter, zu lesen, dass ein rechter Mob mit Fackeln durch Greiz gezogen war und Anwohnerinnen bedroht hatte. Vor einem Haus riefen sie, «Komm runter, du Feigling » und «Spring, wir halten dich nicht auf». Ein Aktivist übertrug den Umzug via Livestream.
Vor der letzten Gemeindekirchenratswahl habe eine Umfrage ergeben, dass 50 Prozent der Kirchgemeindemitglieder AfD-affin seien, sagt Mende. Seit 2021 gilt die Partei in Thüringen für den Verfassungsschutz als rechtsextrem, seit November 2023 auch in Sachsen-Anhalt. Deutschlandweit wird sie als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet.
«Es wird gruselig, ganz gruselig»
Die AfD hetzt gegen Geflüchtete, gegen Muslime und Arme, sie ist, da sind sich Experten einig, europa- und demokratiefeindlich. Trotzdem stiegen ihre Zustimmungswerte jahrelang. Das änderte sich erst – und nur in geringem Masse –, als das Recherchenetzwerk Correctiv Anfang des Jahres öffentlich machte, dass Mitglieder der AfD, Neonazis und rechte Unternehmer die Forderung nach Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland anhand rassistischer Kriterien diskutiert hatten. Mit dabei waren laut den Recherchen auch zwei Politiker der CDU. Proteste in zahlreichen deutschen Städten waren die Folge.
Trotzdem kommt die AfD in manchen Umfragen in Sachsen noch auf rund 35 Prozent, wäre damit stärkste Partei, ähnlich ist es in Brandenburg und Thüringen – in den drei Ländern, in denen im September neue Landesparlamente gewählt werden. Schon vorher finden in neun Bundesländern Kommunalwahlen statt, werden neue Bürgermeisterinnen und Landräte gewählt, im Juni zudem das Europäische Parlament.
Im Greizer Netzwerk für Demokratie würden sie nicht mehr überlegen, wie sie die AfD verhindern, sagt Mende, sondern wie sie mit einem möglichen Wahlsieg umgehen. «Es wird gruselig, ganz gruselig.» Der Kirchenkreis koordiniert die Arbeit des Netzwerks. Bekäme die AfD einen Drittel der Stimmen, wären ohne sie keine Verfassungsänderungen in Thüringen mehr möglich; die Partei würde die Besetzung der Richter mitbestimmen, bereits beschlossene Projekte kippen, auch zur Demokratieförderung und zur direkten Demokratie, befürchtet Mende. Gerade letzteres ist ihm wichtig.
«Wenn extremistische, rassistische und völkisch-nationalistische Einstellungen immer unverfrorener zutage treten, sind wir alle gefordert, zusammen, entschlossen, laut und friedlich für eine offene, tolerante Gesellschaft einzutreten», sagte Anna-Nicole Heinrich, Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anfang Februar. Heinrich sprach auf einer Grossdemonstration in Berlin, die auf die Correctiv-Recherche folgte. Es sei Zeit, für Vielfalt einzustehen, sagte sie.
So wie Heinrich haben sich mittlerweile viele Vertreter der Kirchen klar gegen die AfD positioniert. Sowohl die deutschen Bischöfe wie auch die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Kirsten Fehrs, haben vor einer Wahl der Rechtspopulisten gewarnt.
Aber wo ziehen die Kirchen die Grenze? Und wo bleiben sie offen, offen für Gespräche? Position gegen Rassisten beziehen ist das eine. Komplizierter wird es, wenn Menschen mit populistischen Positionen sympathisieren, die AfD aus Protest wählen, aus Enttäuschung.
«Wir haben in den vergangenen Jahren Menschen verloren», sagt Christian Mende. Die Kirche werde von einigen nur noch als Institution wahrgenommen, die von oben runterredet, von der Kanzel. Die die Notsituation der Bevölkerung nicht mehr wahrnehme. «Ein schöner, goldener Palast, der zugesperrt ist.»
«Manche Meinungen muss man aushalten»
In ländlichen Gegenden sind Kirchen manchmal die letzte öffentliche gesellschaftliche Kraft. Hier kommen Menschen noch jenseits ihrer Bubbles zusammen, treffen unterschiedliche Altersgruppen, Schichten, Berufe aufeinander. Ein Schatz, eigentlich.
Doch diese verbindende Kraft wirkt, so scheint es, immer weniger. Auch weil immer weniger Menschen überhaupt einer Kirche angehören: In Brandenburg etwa sind nur noch 13,5 Prozent der Bevölkerung evangelisch. Und es werden weniger, jedes Jahr rund 2,5 Prozent. Muss die Kirche nicht froh sein um jeden, der kommt?
Neuruppin, ein kleines Städtchen im Norden Brandenburgs, flach und weitläufig, 31 000 Menschen leben hier. Die Klosterkirche Sankt Trinitatis liegt bilderbuchhaft am Ruppiner See. An diesem Tag im November hat der Kirchenkreis einen Experten vom «Mobilen Beratungsteam» eingeladen, der zum Umgang mit Rechtsextremismus berät. Die Anwesenden beschäftigt, wie sie mit Menschen umgehen, die in der Kirche rechtspopulistische Ideen verbreiten.

Die Klosterkirche Sankt Trinitatis ist das Wahrzeichen der Stadt Neuruppin.
Eine Pfarrerin erzählt vom Seniorenkreis in ihrer Gemeinde, plötzlich seien Stammtischparolen gefallen. Gegen Geflüchtete, gegen die Regierung. Und ein Mann sei aufgetaucht, in einem T-Shirt mit eindeutig rechter Symbolik. Vielleicht habe sie zu scharf reagiert, sagt die Pfarrerin und will wissen, wie sie die Beziehung wieder kitten könne. Der Rechtsextremismus-Experte empfiehlt innezuhalten, nachzufragen, auf die Beziehung zu achten, damit das Gegenüber sein Gesicht wahren kann.
Christiane Schulz ist davon nicht ganz überzeugt. «Manchmal muss man einfach klare Kante zeigen», sagt sie bestimmt und wirft ihren Schal über die Schulter. Bei menschenfeindlichen Aussagen zieht sie eine klare Grenze. Bis dahin aber spricht Schulz mit allen, egal was sie wählen oder glauben. Zwischen unterschiedlichen Menschen zu vermitteln ist so etwas wie Schulz’ Beruf. «Wir dürfen uns nicht immer gleich triggern lassen.» Manche Meinungen müsse man aushalten, statt sofort die Gegenposition zu beziehen. Sonst sterbe das Gespräch.
Schulz ist 63, trägt eine knallrote Brille und hat Lachfalten um die Augen. Sie leitet den diakonischen Verein ESTAruppin, koordiniert die Migrations- und Integrationsarbeit der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische-Oberlausitz für den Westen Brandenburgs. Sie hilft, wenn Kirchgemeinden sich für Flüchtlinge engagieren oder Kirchenasyl bieten wollen. Und sie ist im Vorstand eines muslimischen Vereins, als einzige Frau. Für den Dialog.

«Unser Mut ist gefragt», sagt Pfarrerin Christiane Schulz. In ihrer Gemeinde Neuruppin ist sie oft mit dem Rad unterwegs.
Schon die Kinder auf dem Neuruppiner Bauspielplatz, erzählt sie später, würden nicht mehr miteinander reden. Weil die einen Akademikereltern haben und die anderen nicht.
Die AfD kam in Neuruppin bei der letzten Kommunalwahl auf 11 Prozent. Manche in der Stadt rechnen für die nächste Kommunalwahl mit dem Doppelten. Schulz hält nichts von solchen Umfragen. Die Menschen zitterten vor den Zahlen wie die Maus vor der Schlange, sagt sie. Und was dann? Man diskutiert, aber nichts passiert. Schockstarre.
Kirche heisst für Schulz: sich einmischen. In die Gesellschaft, ins Gemeinwesen. Wie damals, als sie und viele andere aus der Region für die «Freie Heide» kämpften, 17 Jahre für eine friedliche Nutzung des nahen Truppenübungsplatzes protestierten. Oder 2007, als sie «Neuruppin bleibt bunt» gründeten, mit einer Sitzblockade einen Naziaufmarsch stoppten, später gegen einen NPD-Parteitag auf die Strasse gingen und heute gegen die AfD.
Schulz lacht viel und breit, wenn sie davon erzählt. Als könne nichts sie erschüttern. Da ist nur ein kurzer Moment, als sie gemächlich durch Neuruppin radelt, gedankenversunken den Kopf schüttelt und sagt: «Wie viele Ressourcen die Rechten haben …»
Man kann viel hineinlesen in diesen Satz: Unsicherheit, Zweifel, Sorge. Angst? Nein, sie habe keine Angst. Nicht vor der AfD und nicht vor Streitgesprächen. «Ich bin gross geworden mit dem Satz: Man kann nicht nicht politisch sein», sagt sie, in ihrem Blick liegt eine Mischung aus Selbstverständ- lichkeit und Herausforderung. Schulz hat Lust am Streiten, nicht am Rechthaben.

In Neuruppin und auch anderen Städten im Osten profitieren Rechtspopulisten von nicht eingelösten Versprechen nach der Wende.
Doch die Polarisierung wächst, Debatten werden anstrengender, viele Menschen hätten inzwischen krude Ideen, sagt sie. «Wir kämpfen seit 30 Jahren gegen rechts, aber die werden immer stärker. Man könnte verzweifeln. Dann denke ich: Vielleicht muss es jetzt gerade so sein. Bleibt die Frage: Was machen wir? Sind wir ängstlich, schliessen die Tür und verstecken uns? Unser Mut ist gefragt.»
Eine starke Zivilgesellschaft ist die vielleicht wichtigste Brandmauer gegen Hass und Hetze. Das Bündnis «Neuruppin bleibt bunt» will bis zur Wahl jeden Monat auf die Strasse gehen.
Wie die AfD die Theologie entdeckt
Die Rechten erstarken derzeit in ganz Europa. Auch in Italien oder den Niederlanden gewannen Rechtspopulisten die Wahlen, in England redeten sie den Brexit herbei. Zumindest aber handelt es sich beim Aufstieg der AfD um ein gesamtdeutsches Problem. Der Osten sei dem Westen nur ein bis zwei Wahlperioden voraus, sagte der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk in einem Radiointerview.
«Vor 1989 behauptete der Osten, alle Nazis würden im Westen leben, seit 1989 läuft es andersrum.» Das schreibt der Publizist und Literaturprofessor Dirk Oschmann in seinem Buch «Der Osten, eine westdeutsche Erfindung.» Beides stimme irgendwie und beides sei falsch. Die Menschen fühlten sich nicht mehr gesehen, so Oschmann weiter, im Bundestag sitze kaum jemand ohne Abitur oder Hochschulabschluss.
Im Osten profitieren Rechtspopulisten von Abwertungserfahrungen nach der Wende, vom nicht eingelösten Versprechen blühender Landschaften, dem Gefühl mangelnder Mitbestimmung. Soziologe Steffen Mau spricht von einer transformationserschöpften oder veränderungsmüden Gesellschaft – und einer AfD, die das auszunutzen versucht. Erfolgreich ist sie damit vor allem abseits der Grossstädte. Auch im Westen: Bei den Landtagswahlen 2023 in Hessen erreichte sie 18 Prozent, in Bayern 14 Prozent.
Dabei schleicht sich rechtsaussen nicht nur in die Mitte der Gesellschaft, sondern auch in die Mitte der Kirche: Stammtischparolen beim Seniorenkaffee, Verschwörungsmythen im Konfirmandenunterricht, Pfarrer, die Corona verharmlosen. In Greiz trat ein aktives Kirchenmitglied aus, weil ihm die Kirche zu positiv über Flüchtlinge sprach, in Görlitz löste sich der Bauausschuss einer Gemeinde auf, weil ein Mitglied den Holocaust leugnete.
Immer öfter versuchen Rechte auch, die Theologie für sich zu vereinnahmen. In der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAG K+R), einem ökumenischen Netzwerk aus kirchlichen Trägern und der Zivilgesellschaft, beobachtet man die erstarkenden Rechtspopulisten. Sie hätten in den letzten Jahren deutlich intensivere Bezüge zum Christentum hergestellt, schreibt Tobias Cremer, Politologe an der Universität Oxford, in einem Text für die Arbeitsgemeinschaft. Kreuze und Kirchenlieder auf Pegida-Versammlungen in Dresden, Kranzniederlegungen vor einer katholischen Heiligenfigur in Paris.
Der christliche Bezug allerdings ist nur oberflächlich: «Das Christentum fungiert in der extremen Rechten vor allem als identitäre Markierung: weiss und anti-islamisch. Die Theologie dagegen ist dünn und das Interesse an Glaubensfragen gering», sagt Henning Flad am Telefon. Der Politikwissenschaftler ist Projektleiter für die BAG K+R. Trotz der Behauptung, das «christliche Abendland» retten zu wollen, handle es sich bei der extremen Rechten insgesamt um ein kirchenfernes Milieu, das sich vor allem für Politik interessiere.
Dennoch: Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, inszeniert sich als frommer Katholik. Einer, der den «christlichen Universalismus» und das christliche «Verständnis von Menschenrechten» ablehnt. Mit «Christen in der AfD» existiert sogar eine eigene Parteigruppierung, deren Leiter Joachim Kuhs aus einer anglikanischen Kirchengemeinde kommt.
Anschlussfähig seien Diskussionen um Gender und sexuelle Vielfalt, aber auch Anti-Feminismus, sagt Flad. Der Politologe unterscheidet klar zwischen Neonazis, die nur noch einen kleinen Teil der extremen Rechten ausmachen, und weiteren Strömungen wie «neuen» Rechten oder Rechtspopulismus. «Gerade weil die, die heute dominieren, keine Neonazis sind, sind sie so gefährlich», sagt er. Sie seien gesellschaftlich weniger leicht zu isolieren.
Entsprechend gross ist bei einigen die Angst, Menschen mit AfD-nahen Positionen könnten als gewählte Kirchenräte in den Gemeinden die Kirche von innen zermürben. Es ist eine lang erprobte Strategie, Vereinsstrukturen von rechts zu unterwandern. Der gute Ehrenamtliche vom Sport- oder Schrebergartenverein, der immer Zeit, immer ein offenes Ohr hat und ganz nebenbei seine Thesen verbreitet.
Der Greizer Christian Mende forderte zur letzten Kirchenwahl in Mitteldeutschland, dass Kandidatinnen und Kandidaten eine Erklärung unterschrieben, für Solidarität und Menschlichkeit. «Wie es die Werte der Bibel sind», sagt Mende. Die Landeskirche lehnte ab; die Pflichten und Rechte von Kirchenmitarbeitenden seien bereits in der Kirchenverfassung geregelt. Mende: «Wir haben als Kirchenkreis explizit Gespräche mit den Kandidaten geführt, um mehr in der Hand zu haben.»
«Hupe, wenn alle Kühe lila sind»
Jörg Michel stöhnt. Ein Auto hat ihm den Parkplatz weggeschnappt. «Da war ich wohl zu christlich», sagt er und lacht. Michel ist an diesem Abend Mitte Dezember auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, der Kirchenchor singt. Michel ist 59, er trägt eine orangefarbene Steppjacke und singt Tenor. Trotz seinen grauen Haaren wirkt er jung, irgendwie alterslos.
30 Jahre war er Pfarrer im sächsischen Hoyerswerda, in der Stadt, die 1991 wegen rassistischer Ausschreitungen gegen Migranten eine zweifelhafte Berühmtheit erlangte. Als Neonazis 2006 «15 Jahre ausländerfrei» feiern wollten, gründete Michel mit anderen das Bündnis Zivilcourage. Später trat er vor dem Ausländeramt in den Hungerstreik, stellte sich mit Jugendlichen einem trötenden AfD-Autocorso entgegen. «Hupe, wenn alle Kühe lila sind», stand auf einem ihrer Schilder.
Jetzt ist Michel Pfarrer in der Kreuzkirche in Görlitz. Die Stadt liegt an der deutsch-polnischen Grenze. Auf der Europabrücke, die Görlitz und Zgorzelec verbindet, ist alles voller Kameras. Mehr als 50 000 Menschen leben in der Stadt an der Neisse; die AfD wurde mit 30 Prozent stärkste Partei bei der letzten Kommunalwahl. Weil sich die anderen Parteien zusammenschlossen, wurde der AfD-Bürgermeister verhindert.
Michel läuft vorbei an der Eisbahn, an Schmalzgebäck und Glühweinständen. Die Bühne für den Chor steht am anderen Ende des Marktes. Alles ist feierlich beleuchtet. Michel schaut sich um, er sucht etwas, oder besser jemanden: den Stand der Görlitzer Freikirche und ihren Leiter. Vergebens.
Das Bühnenprogramm, das sonst von allen Görlitzer Kirchen gestaltet wurde, findet in diesem Jahr ohne die Freie Evangelische Gemeinde statt. Alle anderen evangelischen Kirchen hatten das zur Bedingung gemacht, auch die katholische Kirche hatte sich angeschlossen. Der Grund dafür: Der Pfarrer der Freien Gemeinde machte gegen Geflüchtete Stimmung, verglich die Lokalzeitung mit einer Nazizeitung, diffamierte andere Christen. So zumindest sagt es Michel, der als einziger Stellung bezog – mit einem Artikel in der Lokalzeitung.
«Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerstandslos hinnehmen.» Der Satz von Arthur Schopenhauer hängt bei Michel über dem Schreibtisch. Man müsse den Rechten auf den Füssen stehen, sagt der Pfarrer, «mein Glaube drängt mich zu dem Engagement».
Die Jungen herausfordern
Zurück in Greiz. Es ist Abend geworden. Im Café OK, wenige Schritte vom Kirchgemeindehaus, rücken sie die Tische zusammen. Judith, Noah, Jakob, die Junge Gemeinde. Vier Jungs, sieben Mädchen und Christian Mende. Mende legt zwei Familienpizzen auf den Tisch, Käse, Gemüse, Salami. Sie beten, lachen, reden durcheinander, es geht um Schule, Ausbildung, anstehende Prüfungen, darum, wer Auto fährt und wen mitnehmen kann. Und was mal wird. Gehen oder bleiben, die Frage schwingt auf dem Land immer mit.
Die AfD ist gerade bei den Jungen, vor allem bei jungen Männern erfolgreich. Das zeigen Wahlanalysen. Mende sagt, ein Jugendlicher, der in der Jungen Gemeinde öfter provoziere, sei heute nicht da. Wenn dieser ihn mit rechtspopulistischen Thesen herausfordere, versuche er mit Fakten und Zahlen dagegenzuhalten.
Mende ist in der Jungen Gemeinde beliebt. Einmal habe er eine Zuckerwattemaschine organisiert, erzählte Judith vor dem Treffen, nach dem Gottesdienst habe es Zuckerwatte für alle gegeben.

«Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom», singt Christian Mende in einer Probe vor dem Jugendgottesdienst.
Mende greift nach seiner Gitarre, gemeinsam wird gesungen: Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Danach legt Mende einen Haufen bunter Karten auf den Tisch, verteilt Stifte. Die Jugendlichen sollen Begriffe aufschreiben, Dinge, die es braucht, um gut zusammenzuleben. Meinungsfreiheit, Toleranz, Regeln, schreiben sie. Mende schreibt Freiheit, Solidarität.
Sie reden darüber, was es heisst, ein guter Mensch zu sein. Was Demokratie bedeutet. Um Glauben geht es an diesem Abend nur am Rande.
Als Christ neutral sein? Unmöglich
Der Aufstieg der AfD stellt die Kirchen vor eine Herausforderung. Das zeigt sich in diesem Wahljahr verstärkt.
Es gehe nicht darum, eine einzelne Partei zu bekämpfen, sagt der sächsische Pfarrer Jörg Michel. Es gehe um Werte, um Haltung, darum, ein guter Mensch zu sein. «Man muss Meinungen aushalten, aber man muss sie nicht unwidersprochen hinnehmen.»
Als Christ neutral sein? «Unmöglich», findet Christian Mende. Nicht gegenüber Ungerechtigkeit. «Sich für andere engagieren, das ist, was Christsein ausmacht und worauf wir uns wieder besinnen müssen.» Die Bibel sei eindeutig, sagt er, «wenn dich einer um deinen Mantel bittet, dann gib ihm noch das Hemd dazu».
«Die Rechten haben keine Angst: erstens zu lügen, zweitens zu vereinfachen und drittens mit deinen Emotionen zu spielen», sagt Christiane Schulz. Sie sieht die Aufgabe auch bei den Kirchen selbst. Die evangelische Kirche müsse überlegen, wie sie kommunikativ darauf reagiert – und wie sie Menschen emotionaler anspricht.
Selbst wenn 35 Prozent AfD wählen, sind immer noch 65 Prozent, die es nicht tun. Eine Mehrheit, die zu Tausenden auf die Strasse geht, um für Menschlichkeit einzustehen. Und die zeigt: Demokratie heisst, Verantwortung zu übernehmen. Das geht am besten zusammen.
Kurz bevor Mende sein Büro in Greiz verlässt, fällt ihm noch etwas ein. Er kramt nach einem kleinen Heft, blau, mit einem roten X. Herausgegeben hat das Büchlein ein kleiner Verlag. «Christliches in der AfD» steht drauf.
Das Heft ist leer.