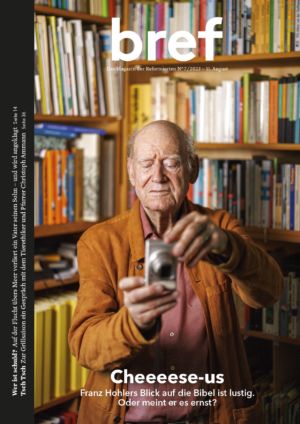Von oben sehen sie aus wie grüne Inseln inmitten einer ansonsten kargen Landschaft: die Waldstücke im Hochland Äthiopiens. Gegen 20 000 solcher Oasen gibt es alleine in Amhara, einer Provinz im Norden des Landes, die dreimal so gross ist wie die Schweiz. Sie sind von weniger als einem bis zu 300 Hektaren gross und haben eines gemeinsam: Mittendrin steht eine Kirche.
Die Kirchen sind auch der Grund dafür, warum es die grünen Oasen überhaupt noch gibt. Rundherum wurde abgeholzt: Waren vor 100 Jahren noch rund 40 Prozent der Fläche von Wald bedeckt, sind es heute noch 4 Prozent. Rund 90 Prozent der äthiopischen Wälder sind verschwunden. Stattdessen entstanden Felder für den Ackerbau und Weiden für die Viehhaltung; das Holz wurde zum Feuern und Bauen gebraucht. Die Bevölkerung wuchs rasant, heute leben 123 Millionen Menschen im Land. Entsprechend stieg auch die Nachfrage nach Nahrungsmitteln.
Dass die Wälder rund um die Kirchen weitgehend unbehelligt blieben, ist lokalen Gemeinschaften zu verdanken. Diese bewahrten die grünen Inseln nicht in erster Linie aus ökologischen, sondern aus religiösen Gründen. Die Gläubigen der christlich-orthodoxen Tewahedo-Kirche halten die Wälder für Abbilder des Gartens Eden aus dem Buch Genesis.
Warum die Wälder für die äthiopisch-orthodoxen Christen so wichtig sind, führte der Abt eines Klosters vor einigen Jahren in einer Reportage des Deutschlandfunks aus: «Der Wald ist wie ein Kleidungsstück für uns, das uns schützt. Wir beten im Wald, unsere Mönche nutzen den Wald als Rückzugsort. Aber natürlich ist er auch wichtig für Schatten und um die Luft zu reinigen. Hier haben wir immer frische Luft», sagte er. Und: «Eigentlich geht es nicht um die Artenvielfalt oder die Rettung des Waldes, sondern um die Achtung der Schöpfung.»
Und doch erfüllen die Wälder wichtige ökologische Funktionen: Einerseits sind sie ein Refugium der Biodiversität und des Artenschutzes. So wachsen dort einheimische Pflanzen, die ausserhalb des Waldes vom Aussterben bedroht sind wie zum Beispiel der Kosobaum, der Weihrauchbaum oder wilder Kaffee. Andererseits bilden die Kirchenwälder eine Art Barriere gegen die fortschreitende Wüstenbildung in der Region: Die Wälder halten den Grundwasserspiegel, senken die Temperatur, Baumkronen und Wurzeln beugen der Bodenerosion vor. Kommt dazu, dass sich in den Wäldern jene Insekten tummeln, die auf den angrenzenden Feldern zum Bestäuben dringend benötigt werden.
Die beiden Ökologen Alemayehu Wassie und Margaret Lowman verfolgen darum das ambitionierte Ziel, den Urwald im Hochland Äthiopiens wieder herzustellen – mit Hilfe der Kirchen. Die Idee: Wenn die Wälder sich ausbreiten, werden sie irgendwann wieder miteinander verschmelzen. Also luden sie vor 13 Jahren 150 Priester zu einem Workshop ein. Mit Bildern von Google Earth zeigten sie auf, wie der Wald schrumpft, woraufhin einer der Priester vorschlug, Steinmauern rund um die Wälder zu bauen. Damit sollten Vieh und Holzdiebe ferngehalten werden. Die simple Idee funktionierte: Wo Mauern gebaut wurden, regenerierte sich der Wald, die Luft wurde besser, der Bestand an Vögeln, Insekten und Wildtieren nahm zu – und die Mauern hinderten den Wald nicht daran, sich auszubreiten.
Glauben als Potenzial für den Umweltschutz
Der schottische Fotograf Kieran Dodds hat in seinem Buch «The Church Forests of Ethiopia» die Kirchenwälder fotografisch dokumentiert. Seine Bilder, aufgenommen vom Boden und aus der Luft, zeigen eindrücklich die klar gezogenen Grenzen zwischen Feld und Wald, zwischen Zeiten der Arbeit und solchen der Spiritualität.
Die Bilder geben ausserdem Einblicke in den Glaubensalltag der äthiopisch-orthodoxen Christen sowie deren Kirchen, die in der Regel Hunderte von Jahren alt sind. Das Christentum wurde bereits im 4. Jahrhundert durch zwei griechische Brüder in die Region gebracht. Das damalige Königreich von Aksum wurde zum ersten christlichen Staat Schwarzafrikas überhaupt. Heute sind über 80 Prozent der Bevölkerung Amharas christlich-orthodox, der Rest ist muslimisch.
Seine persönlichen Erlebnisse im Wald beschreibt Dodds im Buch als eine Art spirituelle Erfahrung: «Wenn man in den Wald hineingeht, weicht die trockene Stille der Felder der kühlen, duftenden Luft des Waldes, erfüllt von einer Kakophonie des lebendigen Gesangs. Die Geräusche von Insekten, Vögeln und Affen steigen mit den menschlichen Stimmen in die Baumkronen und in den Himmel auf.»
In Äthiopien und ganz Afrika laufen Anstrengungen, die Folgen der Klimaerwärmung und der fortschreitenden Verwüstung zu mildern. So will zum Beispiel die Afrikanische Union auf einem Gürtel in der Sahelzone quer durch den Kontinent Bäume pflanzen und ausgetrocknete Böden wieder fruchtbar machen. Die Kirchenwälder Äthiopiens sind nicht Teil dieses unter dem Namen «Grüne Mauer» bekannten Megaprojektes.
Für Fotograf Kieran Dodds erinnern sie gleichwohl daran, dass Umweltschutz nicht nur bedeutet, neue Bäume zu pflanzen, wie er im Begleittext zu seinem Fotobuch schreibt. Sondern auch, über Jahrhunderte gewachsene grüne Oasen zu schützen und zu bewahren. Die Kirchenwälder zeigten zudem, dass in der Religion ein vielleicht unterschätztes Potenzial für den Umweltschutz liegt. «Im säkularen Westen können wir spirituelle Gesichtspunkte leicht übersehen, wenn wir nach Möglichkeiten suchen, die Umwelt zu schützen», schreibt er im Buch. «Wie diese Bilder zeigen, haben spirituelle Überzeugungen nach wie vor die Kraft, zu bewahren und zu heilen.»

Aussen das Feld, innen die Kirche: Die Kirchenwälder Äthiopiens trennen Arbeit und Spiritualität. Um manche Kirchen wie Mekame Meskel (Bild) wurde eine Steinmauer errichtet, um sie vor Vieh und Holzdieben zu schützen.

Gläubige beten in ihren Sonntagsgewändern im Kirchenwald von Zhara.

Die Landwirtschaft hat den Wald in den letzten Jahrzehnten zurückgedrängt. Im Bild ein Bauer mit einem Pflug in der Nähe des Kirchenwalds von Mekame Meskel.

Farblich kaum von den Wandmalereien zu unterscheiden: Zwei Priester stehen an der Tür zum Allerheiligsten in der Robit-Bahita-Kirche (Region Süd-Gonder).

Gläubige beten in ihren Sonntagsgewändern im Kirchenwald von Zhara.

Einheimische Frauen marschieren durch den Kirchenwald, um zum Kloster Robit Bahita (Region Süd-Gonder) zu kommen.
Kieran Dodds: «The Church forests of Ethiopia». Hide Press, Edinburgh, 2021.
Das Titelbild zeigt die steilen Hängen neben der Kirche Tenta Cherkos, auf denen neue Bäume gepflanzt werden (rechts im Bild).