Tausend tanzende Sterne
In der Dunkelheit des späten Abends ist die Warteschlange kaum zu erkennen. Nur die Vordersten, diese Glücklichen, leuchten im Spotlicht über der Eingangstür. Aufgekratzt stöckeln und stampfen sie vor dem Türsteher herum und brennen darauf, den Basstönen zu folgen, die ungehindert nach draussen dröhnen. Wir stehen hinten an, und nach einer Weile in der klirrenden Kälte lässt der Mann im schwarzen Outfit auch uns passieren. Schickt uns die steile Treppe hinunter.
Dann geht es schnell: Zahlen. Stempel aufs Handgelenk. Jacke abgeben. Rein ins Getümmel. Wir verlieren uns in der wogenden Menge. Ich lasse mich treiben vom Takt und dem Tempo der Musik. Merke nicht einmal, wie Zeit und Gedanken verfliegen. Spüre bloss, wie sich der Körper erwärmt, wie er leichter wird und schwebt. In diesem Kosmos mit seinen tausend Sternen. Sie funkeln überall, in allen Farben, lassen Boden, Decke und Wände verschwinden, tanzen auf meinem Shirt und in den Gesichtern der Menschen, die neben mir kreisen. Die Discokugel wirft ihre leuchtenden Punkte auf jede und jeden, lässt niemanden aus. Sie blendet und glitzert und dreht und dreht sich und ich drehe und drehe mich, drehe mich um sie herum, schwimme in diesem Lichtermeer, das mich erst nach Stunden wieder hinausspült, in die Dämmerung, auf die Strasse, auf den Heimweg, auf dem ich, wenn ich Glück habe, noch vor dem Ankommen der Morgensonne entgegenblinzle. hz

Mikroabenteuer an der Feuerstelle
Kürzlich habe ich einen Podcast über Mikroabenteuer gehört. Was ist denn das schon wieder, mögen Sie sich fragen, und seien Sie gewiss, mir ging es genauso. Welchen Hype soll ich nun schon wieder mitmachen, dachte ich, bereits etwas ermüdet. War es denn noch nicht genug mit dem Fermentieren, dem Selber-Pilze-Züchten und der Achtsamkeit-Meditation schon vor dem Morgengrauen?
Nun, nachdem ich den Podcast gehört habe, kann ich Sie beruhigen: Ein Mikroabenteuer ist schlicht das, was man früher als Ausflug bezeichnet hat. Und zu einem solchen möchte ich Sie verführen: Packen Sie einen Rucksack mit etwas trockenem Holz, einigen Anzündwürfeln, einem Feuerzeug und Proviant. Gehen Sie los in den Wald und entfachen Sie ein Feuer – nach Einbruch der Dämmerung, versteht sich. Denn das Licht eines Feuers in der Nacht ist unschlagbar. Die Gelb-, Orange- und Rottöne, vermischt manchmal sogar mit Blau, können den Blick minutenlang gefangen halten. Wangen und Nasenspitze werden dabei leuchtend warm, während sich über dem Rücken eine angenehme Kühle ausbreitet. Das Knacken im Geäst, das Rauschen der Blätter – alles wird intensiver wahrgenommen, gerade weil die Sicht beschränkt ist. Wir sehen nur, was das Feuer zulässt, und spüren andere Dinge dafür umso stärker.
Das gilt auch für den Geschmack: Kein Cervelat hat je so gut geschmeckt wie derjenige, den man direkt vom Holzspiess knabbert, kein Brot war je so knusprig wie das, was man mit spitzen Fingern vom heissen Stein gerollt hat. Selbst den Glühmost aus der Thermoskanne empfindet man plötzlich nicht mehr als klebrig, sondern als wohlig wärmend. Und wenn die Glut dann zu einem sanften Glimmen zusammengefallen und die Kälte über die Schultern nach vorne gekrochen ist, löscht man das Feuer mit mitgebrachtem Wasser oder, wenn man einen Mann dabei hat … naja, Sie wissen schon. vbu

Den Fokus verengen
Es ist nicht mehr ganz Tag und noch nicht ganz Nacht, als wir loslaufen. Anfangs waren wir uns fremd, verbunden nur durch die Leidenschaft zu laufen. Mittlerweile sind wir ein gutes Gespann, meine Joggingpartnerin und ich. Gleichmässig klopfen unsere Schritte an diesem Abend auf den Asphalt, führen uns hinein in den Wald. Unser Atem lässt kleine weisse Wolken steigen. Noch bleibt Luft, um zu sprechen. Wir tauschen uns aus über Alltägliches und Besonderes, das uns umtreibt. Immer weiter weg von den Strassen der Stadt laufen wir, immer stiller werden wir.
Über uns bilden Blätter und Bäume ein dunkles Dach, unter uns illuminieren die Stirnlampen den Weg. Deren Kegel erfassen einen engen Radius und bringen bloss das zum Vorschein, was uns unmittelbar umgibt. Schemenhaft sind Silhouetten der Äste erkennbar, Schattierungen von Braun, Grau und Schwarz. Ferse lösen, Mittelfuss, Zehen in die Luft, nächster Schritt. Die Stirnlampe wirkt wie eine Fotolinse, sie verengt den Blick und trägt bei zum Fokussieren. Mit jedem Meter wird der Kopf leerer, das Herz voller.
Selten fühle ich mich so frei, wie wenn ich laufe. Die Ruhe lässt mich im Moment sein. Es gibt kein Vor- oder Nachher, nur das Jetzt. An diesem Abend sind wir allein im Wald. Wir begegnen keinen Spaziergängern mit Hunden, keinen Familien mit Kinderwagen, keinen Reitern oder Radfahrern. Auch die Tiere bleiben unsichtbar. Versteckt unter Laubbergen, verborgen hinter Fichten und Föhren. Nach einer guten Stunde sind wir zurück bei unserem Ausgangspunkt. Wir knipsen unsere Stirnlampen aus. Am Horizont leuchtet die Skyline der Grossstadt in den schwarzen Himmel. Es ist nicht mehr Tag, es ist ganz Nacht geworden. jow
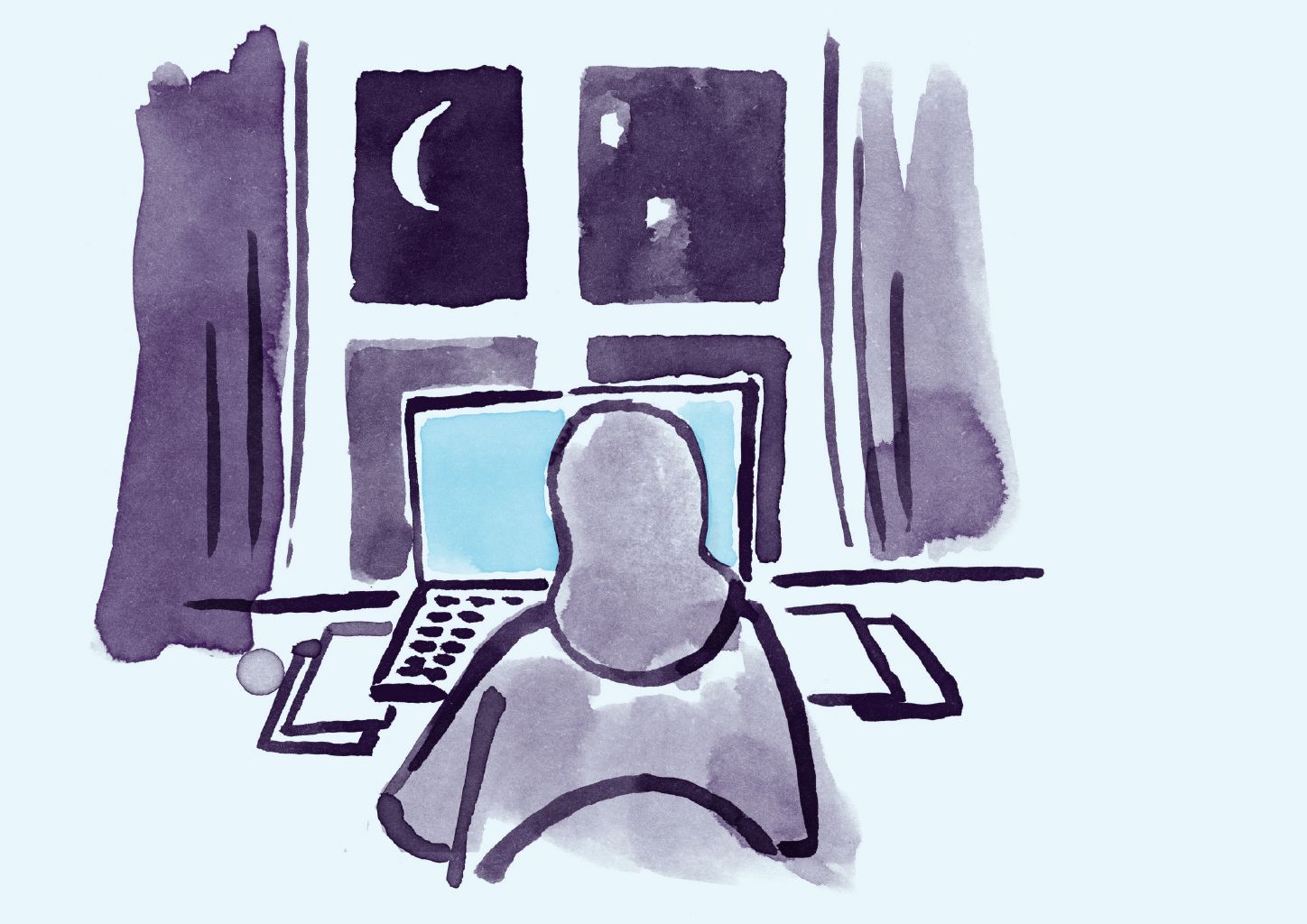
Nächtliche Bildschirm-Episoden
Ich liebe es, mitten in der Nacht auf einen Bildschirm zu schauen. Damit meine ich nicht den flüchtigen Blick aufs Handy, wenn ich aus einem Traum hochgeschreckt bin oder eben schlaftrunken vom Pinkeln zurückkomme. Nein, ich meine dieses fokussierte Schaffen, diesen ganz besonderen kreativen Flow, der sich nur dann einstellt, wenn man gänzlich ungestört ist von der Welt und ihren Belangen.
Wenn ich spüre, dass nicht mit Schlaf zu rechnen sein wird, setze ich mich an den Laptop und schreibe. Dabei vermischt sich das bläuliche Schimmern des Bildschirms mit dem warmen Schein der Schreibtischlampe. Es ist, als sässe ich in einem Kokon aus Licht, in dem ich vor der Dunkelheit geschützt bin. Ein Ort, der nur mir gehört. Das ganze Haus, mein Quartier und der angrenzende Wald, sogar die Stadt unten am Hügel – alles ist ruhig. Nichts muss mich kümmern, einzig die Buchstaben auf meinem Bildschirm sind von Bedeutung. Derart eingehüllt, fällt mir das Schreiben oftmals leichter, lösen sich harzige Textstellen, fallen Wörter an ihren Platz. Schon ganze Artikel habe ich in solchen Situationen geschrieben, manche davon in die Notiz-App meines Handys, wenn mein Körper zu müde war zum Aufstehen, aber der Kopf einfach keine Ruhe geben wollte.
Die britische Schriftstellerin Katherine May schreibt in ihrem Buch «Überwintern» von Zeiten, in denen unser Alltag «auf Eis liegt und wir uns fühlen wie aus der Welt gefallen». Ausgelöst durch Krankheit, Verlust oder auch die Geburt eines Kindes, sind das Zeiten des Rückzugs, des Innehaltens und der Einkehr. Es sind aber auch Zeiten, in denen wir Kraft sammeln für unseren persönlichen Frühling – selbst wenn in diesem Moment noch sämtliche Oberflächen brachliegen.
So ähnlich sind solche nächtlichen Bildschirm-Episoden für mich. Eine Art Mini-Überwinterung, bevor das Leben wieder seinen Lauf nimmt. Ein Rückzug an einen Ort voll schummrigen Lichts, an dem es nur mich gibt – mich und meinen Bildschirm. vbu
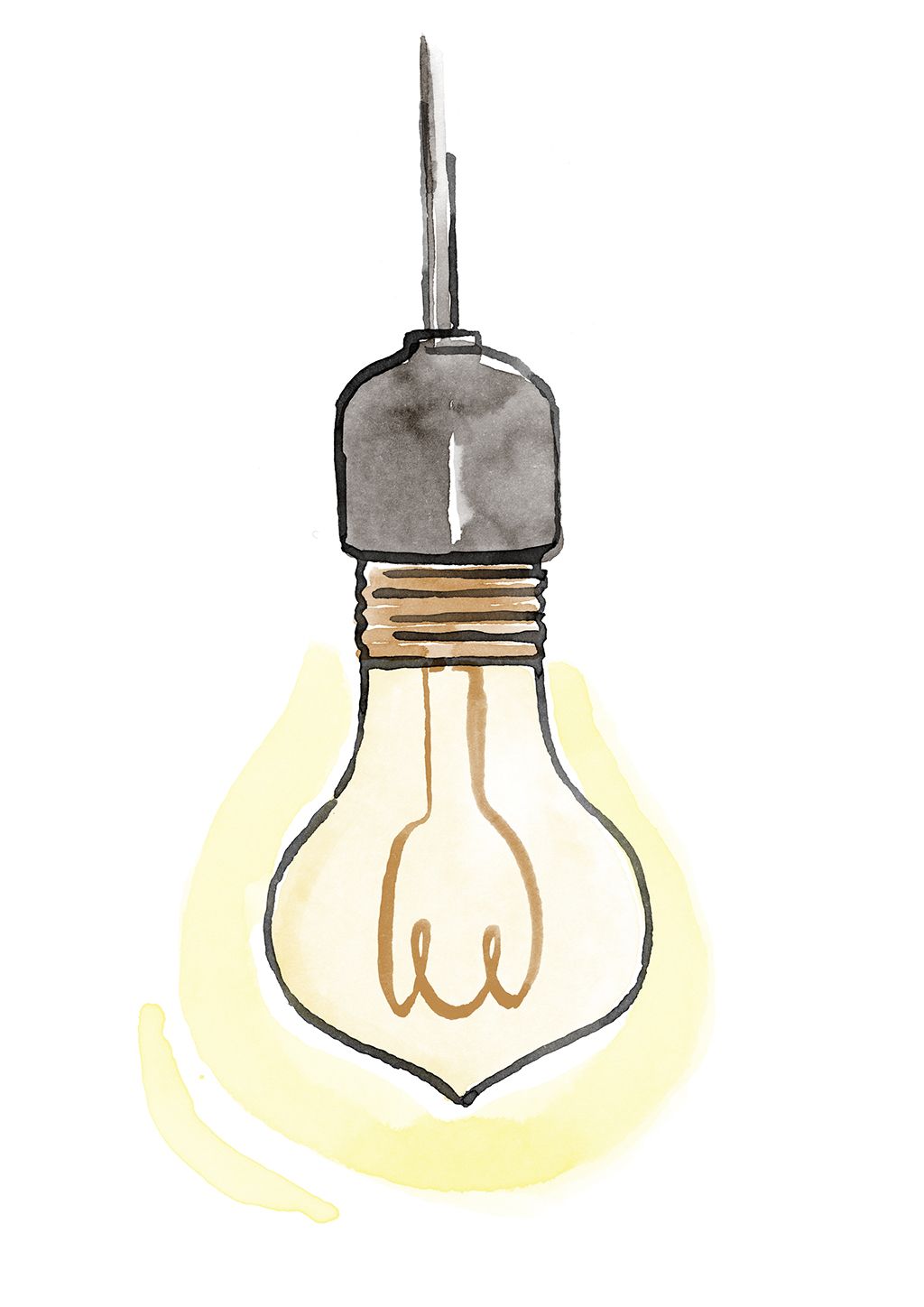
Das fast schon ewige Licht
Trauen Sie sich wegen der Energiekrise kaum noch, den Lichtschalter zu betätigen? Dann trösten Sie sich damit: Es gibt eine Lampe, die immer brennt – und das seit 120 Jahren! Die Welt lieferte sich Kriege, machte industrielle und digitale Revolutionen durch, es leben fünfmal mehr Menschen auf der Welt als vor 120 Jahren. Doch das Licht dieser Lampe leuchtet heute wie damals, schwach, aber beständig.
Die «Jahrhundertglühlampe» hängt zwar in Kalifornien, genauer gesagt in einer Feuerwache der Stadt Livermore. Doch wann im-mer es Ihnen danach ist, können Sie sie im Internet betrachten. Eine Webcam übermittelt einen zugegebenermassen mittelmässig abwechslungsreichen Livestream.
Die Feuerwehr schreibt auf der Homepage, dass die Webcam seit ihrer Installation dreimal ausgewechselt werden musste. Die Lampe dagegen blieb dieselbe. Nur äussere Umstände konnten ihr etwas anhaben. Zum Beispiel als die Feuerwehr umzog und sie für den Transport abmontiert werden musste. Dunkel blieb es in der Feuerwache Livermore aber nie länger als für einige Stunden.
Die langlebige Leuchte ist längst zum Vorbild punkto Nachhaltigkeit geworden. Das mag irritieren, bittet uns der Bund doch auf Plakaten, in Inseraten und Werbespots inständig darum, das Licht nur, wenn es wirklich nötig ist, anzulassen. Doch die Glühlampe von Livermore zeigt, dass ein Produkt von Qualität besser für die Umwelt und auf lange Sicht auch günstiger ist als der rasche Konsum und das Wegwerfen von Verschleissprodukten. Das ist wirklich ökologisch und muss uns die mageren 4 Watt Energie pro Stunde, welche die Lampe verbraucht, wert sein – Strommangel hin oder her.
Und sollten Sie nun noch immer ein schlechtes Gewissen haben, Ihren Lichtschalter zu betätigen, dann denken Sie einfach an die Glühbirne von Livermore und wärmen Sie sich an dem Gedanken, dass irgendwo ein Licht brennt, ununterbrochen. Geschehe, was wolle. eba
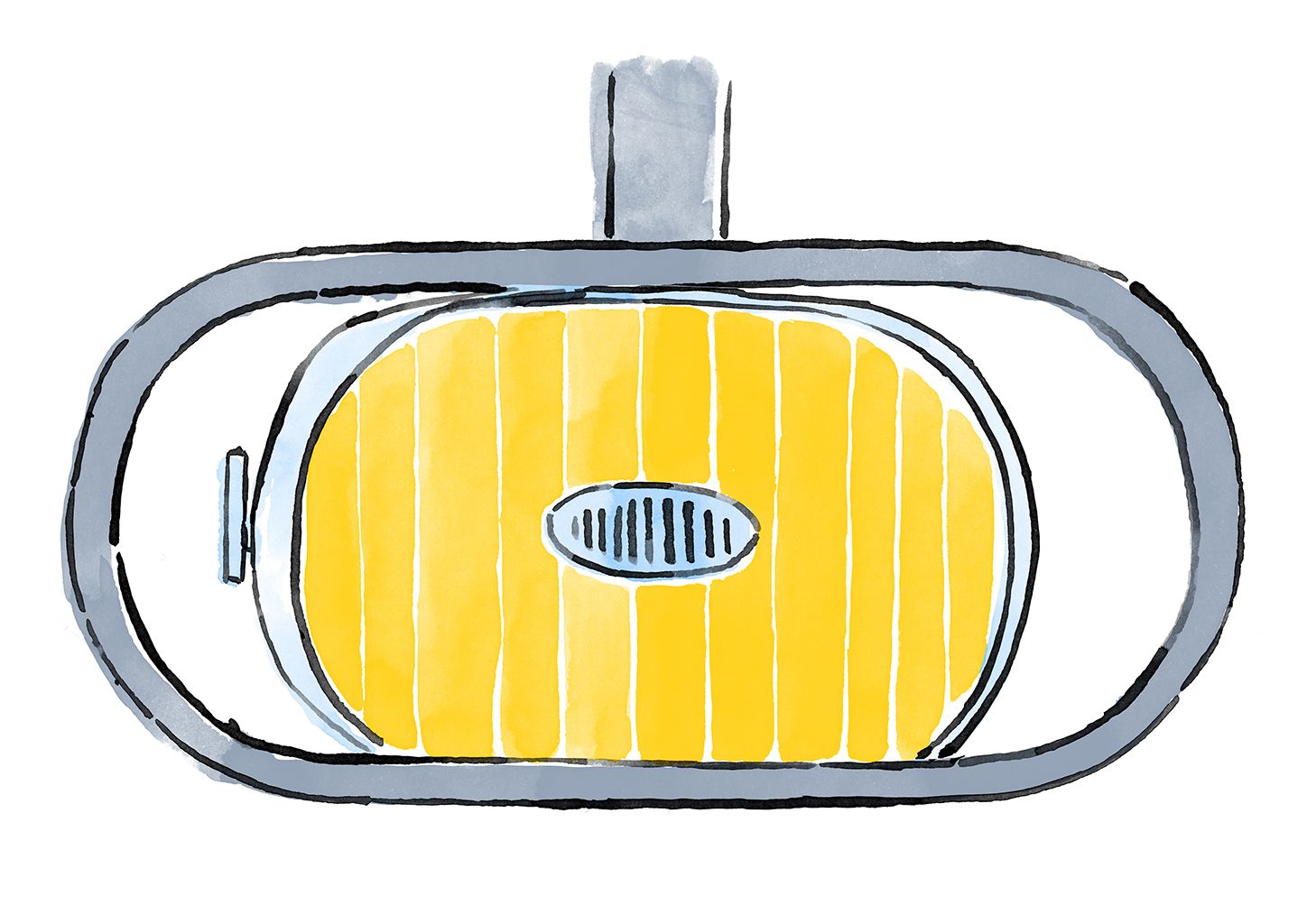
Auf dem Zahnarztstuhl
Die Rolle Zahnseide lag stets prominent auf dem Spülbecken und erinnerte mich immer wieder daran, dass ich schon lange keine Zahnarztpraxis mehr aufgesucht hatte. Aber weder die Seide noch das dritte Erinnerungsschreiben der Dentalhygienikerin hatten mich ausreichend motiviert, endlich einen Termin zu vereinbaren. Trotz den mahnenden Worten im Brief, dass mich das Vernachlässigen der Zahnpflege einige Lebensjahre kosten würde. Der Zettel wanderte aufs Altpapier, wo er zwei Wochen mitten im Stapel auf die Abfuhr wartete.
Ich war schon dabei, das Papierbündel zu schnüren, als mir plötzlich die Bilder des letzten DH-Besuchs durch den Kopf schossen. Und da sah ich – auf dem Zahnarztstuhl liegend – nicht nur die grossen Augen der Zahnärztin vor mir, nicht nur den blutroten Speichel, der nach dem Spülen strudelartig vom Becken verschluckt wurde, nachdem die fiese Kürette mein Zahnfleisch zerstochen hatte – nein, ich sah da vor allem: Licht. Ganz viel Licht. Flirrendes Licht, das einen im Stuhl liegend beinahe abheben lässt, würde man vor lauter Anspannung nicht die Fingernägel in die Armlehnen bohren und die Beine so verkrampft ausstrecken wie auf dem Beifahrersitz eines Rasers.
Ich erinnerte mich, wie schön es doch ist, in die hellen Tiefen der Behandlungslampe einzutauchen. In diesem Gleissen zu verweilen und den magischen Effekt zu geniessen, der entsteht, wenn man, eben noch geblendet, die Augen schliesst, und dann auf einmal viele bunte Punkte und Formen durch die Dunkelheit tanzen, als würde man in ein Kaleidoskop schauen. Halb geflasht, suchte ich nach dem Erinnerungsschreiben, zog es aus dem Papierstapel und wählte die Nummer der Praxis. Jetzt freue ich mich auf das Licht und die strahlend weissen Zähne, mit denen ich bald wieder lächeln kann – mindestens so lange, bis die saftige Zahnarztrechnung ins Haus flattert. hz
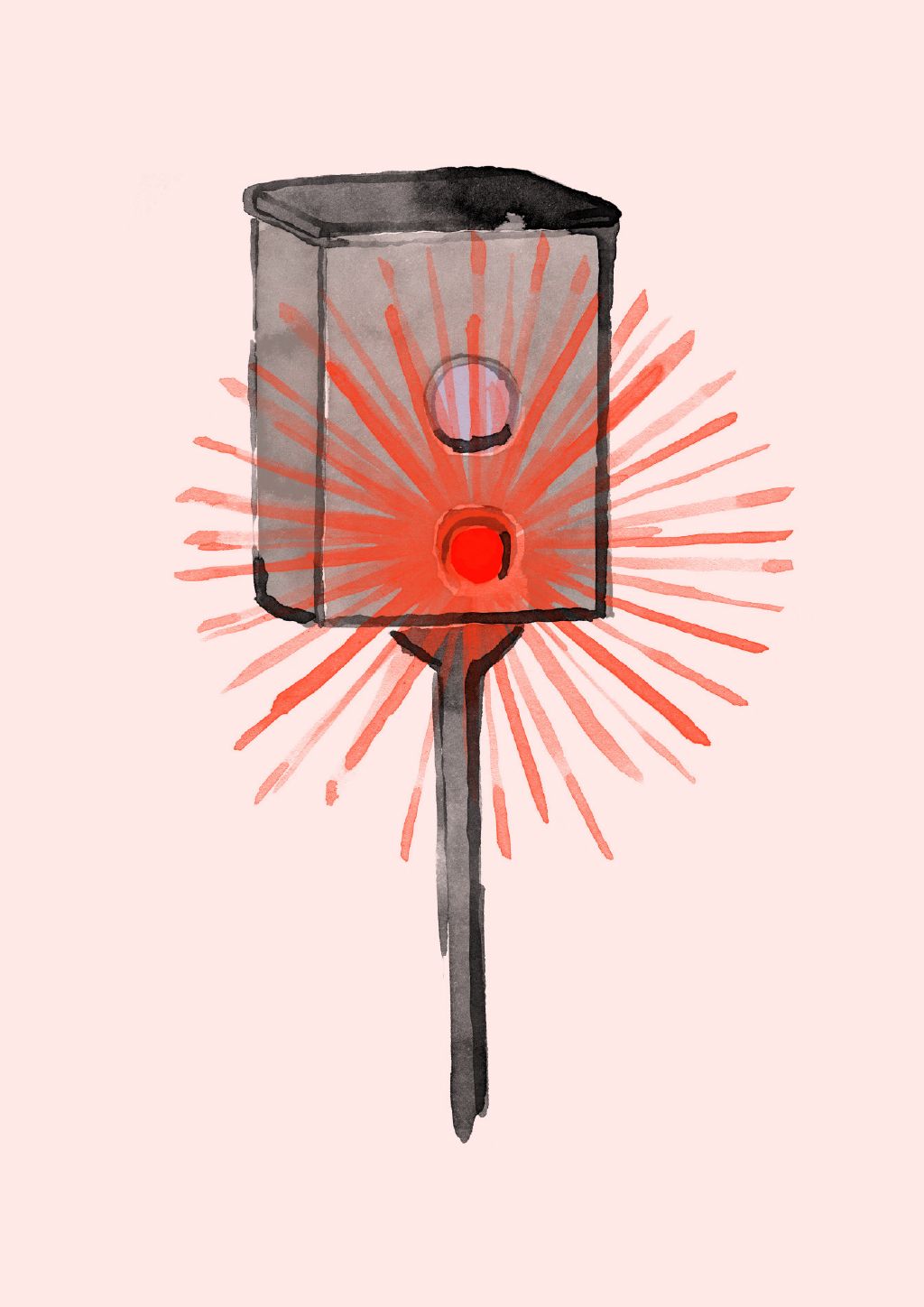
Die letzte Fahrt
Seit zehn Jahren besitze ich ihn nun. Eines Tages könnte er nützlich sein, habe ich mir immer gesagt. Doch der Glaube daran schwindet. Die letzten sieben Jahre verbrachte mein Führerschein unbenutzt und vergessen in meinem Portemonnaie. Was soll ich damit in der Stadt, wenn ich ihn schon auf dem Land nicht gebraucht habe? Doch nun, als die Tage kurz und die Energie knapp geworden ist und ich auf der Suche nach einer der letzten Lichtquellen bin, kommt er mir wieder in den Sinn. Ich könnte doch …
In meinem Quartier stehen mehrere rote Autos für Leute wie mich. Ich überlege mir, eines für den späteren Nachmittag zu mieten. Ich stelle mir vor, wie ich einsteige, mich wieder mit Gas und Kupplung vertraut mache und etwas gestresst den Weg aus der Stadt suche. Die Dämmerung ist angebrochen, zäh fliesst der Verkehr, endlich gelange ich auf die A 12. Planlos folge ich ihr. Als geübter Fahrer wüsste ich wohl genau, wohin. Aber das macht mir nichts aus. Vorfreude und Überraschung machen es nur noch schöner.
300 Kilometer weiter ist es dann so weit. Kurz und grell ist der Blitz. Ein befriedigendes Gefühl der Wärme überkommt mich. Die Suche wurde belohnt. Und zwar gleich doppelt. Im Rückspiegel nehme ich zwei weitere Lichtquellen wahr. Rot und Blau wechseln sich ab. Leicht berauscht vor lauter Licht fahre ich auf den Pannenstreifen und bringe das Fahrzeug zum Stehen. Mein Tagtraum endet. Und ich denke: Zeit, den Führerschein abzugeben. pef


