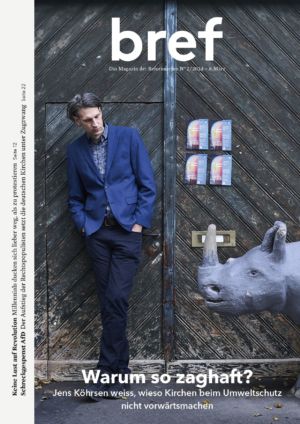Es geschah an einem nasskalten Abend im letzten Advent. Auf der Suche nach etwas Zerstreuung am Ende eines langen Bürotages scrollte ich durch Instagram, als mir plötzlich ein ziemlich schöner Adventskranz in die Timeline gespült wurde. Selbst begeisterte Kranzflechterin, klickte ich das Profil an. Zwei Minuten später steckte ich angewidert mein Handy weg. Ich war in der Belanglosigkeits-Vorhölle gelandet.
Gerade Instagram ist voll von Frauen in meinem Alter, die sich eine zweite Karriere als Influencerin aufzubauen versuchen. Die einen posten Bio-Babybrei-Rezepte oder Anleitungen für Weihnachtssterne aus Recycling-Papier.
Die anderen sind vermeintlich gleich ganz aus der postmodernen Hektik ausgestiegen und zeigen nun Bilder von ihrem selbstrenovierten Häuschen auf dem Land, wo sie Hühner halten und Sauerteig ansetzen. Ein bisschen nachhaltig wollen sie sein, dabei hip, aber nicht Mainstream, was sie in ihren jeweiligen Bubbles natürlich trotzdem sind. Das wichtigste Kriterium für ihre Beiträge aber scheint zu sein, bloss niemandem weh zu tun.
Diese Frauen sind für mich der Inbegriff dessen, was Soziologen als Generation Y oder auch als Millennials bezeichnen (siehe Kasten). Diesen Menschen, die wie ich zwischen Anfang der achtziger und Mitte der neunziger Jahre geboren wurden, sagt man nach, mehr Wert auf Selbstverwirklichung denn auf Karriere zu legen.
Böse Zungen meinen gar, wir hielten uns gerne alle Optionen offen und drehten uns vor allem um uns selbst. Zudem sind wir die erste Generation, die in einer vollends globalisierten Welt aufgewachsen ist und für die das Internet definitiv kein Neuland mehr ist. Das macht uns zumindest in der Theorie weltoffener als unsere Eltern und Grosseltern. Auch sollen wir mehr Dinge hinterfragen, etwa die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt.
Umgangssprachlich wird unter dem Begriff «Generation» eine bestimmte Altersgruppe verstanden. Deren Angehörige sind im selben Zeitraum unter ähnlichen Bedingungen aufgewachsen und teilen darum – so die Theorie – gewisse Merkmale und Eigenschaften. Folgende Generationen werden unterschieden:
Babyboomer: Etwa 1945 bis 1965
Generation X: Etwa 1965 bis 1980
Generation Y/Millennials: Etwa 1980 bis 1995
Generation Z: Etwa 1995 bis 2010
Generation Alpha: Etwa 2010 bis 2025
Das «Etwa» rührt daher, dass die verschiedenen Generationen nicht trennscharf definiert sind, je nach Quelle werden andere Jahrgänge dazugerechnet. Vergleiche werden auch dadurch erschwert, dass viele wissenschaftliche Studien nicht mit Generationen arbeiten, sondern mit frei zusammengesetzten Altersgruppen – je nachdem, wo das Interesse der Forschenden liegt. vbu
Für diesen angeblich kritischen Geist gibt es allerdings wenig Belege, geschweige denn dafür, dass wir daraus ein gewisses Engagement ableiten würden. Eher im Gegenteil: Nimmt man die drei bis vier Urnengänge pro Jahr als Mindestmass einer zivilgesellschaftlichen Beteiligung, dann dümpeln wir Millennials gerade mal so im Mittelfeld.
Spitzenreiter bei der Wahlbeteiligung sind die älteren Generationen – auch wenn einige Studien nahelegen, dass es sich dabei um einen generellen Alters- und nicht um einen Generationeneffekt handelt. Der politische Aktivismus dagegen wird eher geprägt von Menschen, die um die Jahrtausendwende herum geboren wurden, also von der sogenannten Generation Z.
Auch beim Klimawandel, einem der drängendsten und am meisten diskutierten Themen unserer Zeit, können wir uns nicht gerade mit Lorbeeren schmücken. So liegt der CO2-Verbrauch der Menschen ab 55 in der Schweiz bei 9,8 Tonnen pro Jahr, wie eine im Januar von Sotomo publizierte Untersuchung zeigte. Der Verbrauch der 30- bis 39jährigen dagegen beträgt satte 11,4 Tonnen – so viel wie bei keiner anderen Altersgruppe. Besonders ins Gewicht fallen Flugreisen und gleich dahinter der allgemeine Konsum. Der durchschnittliche CO2-Fussabdruck liegt in der Schweiz bei 10,5 Tonnen.
«Es scheint, als seien wir mit unserer angeblich so aufgeklärten und kritischen Art auf halber Strecke stehengeblieben.»
Zyniker mögen nun gleich Luft holen, um mit Blick auf den ebenfalls nicht gerade niedrigen Verbrauch der 18- bis 29jährigen (10,7 Tonnen) lauthals zu rufen: «Aber die Generation Z!» und «Aber diese Schüler-Aktivisten!» So als wäre es an den Jüngsten unter uns, den nachhaltigsten Lebensstil zu pflegen, so als gäbe es nicht auch ein gewisses Recht auf Unvernunft in jungen Jahren.
Wir jedoch sollten dieser Unvernunft entwachsen sein. Wir sind in einem Alter, in dem zumindest die meisten von uns ihren Platz im Leben gefunden haben. Wir haben das Wissen, oftmals das Geld und manchmal sogar die Position, um etwas zu verändern.
Doch es scheint, als seien wir mit unserer angeblich so aufgeklärten und kritischen Art auf halber Strecke stehengeblieben. Fragen Sie zehn Millennials, ob sie sich Sorgen um den Klimawandel machen, antworten wahrscheinlich zehn mit Ja. Fragen Sie sie, ob sie schon einmal an einem Klimastreik teilgenommen haben, sieht die Antwort ganz anders aus.
Banale Freuden
Natürlich kann man uns zugute halten, dass wir gerade in einem ziemlich anspruchsvollen Alter sind: Wir reiben uns auf zwischen Budgetmeeting und Elternabend, versuchen zwischen dem Auftragen des Lidschattens und dem Wegwischen der Kinderkotze nicht die Nerven zu verlieren oder stemmen nach den ersten Jahren im Job bereits Weiterbildungen oder gar eine berufliche Neuorientierung.
Das alles kostet Zeit, Geduld, Energie. Schon klar, dass es schwierig ist, die Welt zu retten, wenn man in erster Linie damit beschäftigt ist, im Alltag nicht unterzugehen.
Unter diesen Umständen ist es legitim, sich hin und wieder etwas zurückzuziehen. Sich schönen und vermeintlich belanglosen Dingen zu widmen, wie es manche Influencerin auf Instagram tut. Selbst George Orwell, der vielen als Inbegriff des politischen Autors gilt, pflegte in seinem Zuhause im englischen Dorf Wallington einen Garten. Daraus versorgte er sich nicht nur selbst mit Gemüse, sondern er pflanzte auch so etwas ganz und gar Unnützes wie Rosen an – einfach weil es ihm Freude bereitete. Und weil die Blumen ein Schnäppchen bei Woolworth waren, wie Rebecca Solnit in ihrem Buch «Orwells Rosen» schreibt.
In diesem grandiosen Werk zeichnet die amerikanische Essayistin nach, welchen Stellenwert das Gärtnern für Orwell hatte: «Er wollte einen Garten, und er wollte darin arbeiten, um eigene Nahrung zu produzieren, aber auch weniger Greifbares. Er wollte Blumen, Obstbäume, Gemüse, Hühner, Ziegen. Er wollte die Vögel, den Himmel und die Jahreszeiten sehen. Er liebte das Antlitz der Erde, wie es in seinem Credo heisst.»
Er schreibe, um gehört zu werden, wird Orwell im Buch zitiert, weil er eine Lüge entdeckt habe, die er aufzeigen wolle. «Aber ich könnte weder ein Buch noch einen längeren Artikel für eine Zeitschrift schreiben, wenn es nicht auch ein künstlerisches Erlebnis wäre.» Mit anderen Worten: Orwell ging es bei seiner Arbeit um die Veränderung des Status quo, die Auflehnung gegen Totalitarismus, Propaganda und eine Verrohung der Sprache. Die Kraft für diesen Kampf schöpfte er aus der Schönheit – der Schönheit von Kunst und Literatur, von Rosen, Kürbissen und bisweilen sogar Kröten.

Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zu dem, was ich in meiner Generation beobachte: Wir nehmen zwar das Schöngeistige für uns in Anspruch, die Zerstreuung, die angeblich simplen Freuden wie Sauerteig und selbstgemachte Adventskränze. Doch wir leiten daraus keine politische Kraft ab, und erst recht keine Veränderung.
Wir wissen zwar, dass Fliegen dem Planeten schadet, sind aber zu beschäftigt damit, uns im Yoga-Retreat auf Bali selbst zu finden, um wirklich in den Kampf gegen den Klimawandel einzusteigen. Wir laufen mit dem Konterfei von Che Guevara auf der Brust herum, doch reicht unsere Kapitalismuskritik gerade einmal so weit, dass wir den Takeaway-Kaffee nicht mehr bei Starbucks kaufen, sondern in der Independent-Rösterei aus dem Zürcher Oberland. Wir haben Stofftaschen, auf denen «Smash the Patriarchy» steht, und sind doch in den gleichen Beziehungsgefällen gelandet wie unsere Mütter und Grossmütter.
Ich nehme mich selber da gar nicht aus. Vor dem grossen Frauenstreik 2019 habe ich nur an einer einzigen Protestaktion teilgenommen – einer doch eher zahmen, um nicht zu sagen halbherzigen Schülerdemo gegen den Einmarsch der USA im Irak. In meinen Zwanzigern gab es Jahre, in denen ich mich ohne zu zögern sechs oder gar acht Mal in ein Flugzeug gesetzt habe, Hin- und Rückflüge zusammengenommen. Und noch heute kaufe ich viel zu viele Dinge, die ich nicht brauche, allen voran Kleider und Schuhe.
Wir sind so unglaublich lebenssatt – und kriegen doch den Hals nicht voll. In unserer Vorstellung scheint es von allem immer mehr zu geben. Weil es immer so war.
«Work hard, play hard»
Wir wurden in eine Zeit des Fortschritts und der Stabilisation hineingeboren. Mit dem Ende des Kalten Krieges fiel ein grosses Sicherheitsrisiko weg, und der einsetzende digitale Wandel liess die Welt näher zusammenrücken. Die grosse Liebe war in meiner Jugend immer nur einen Mausklick entfernt (ja, vor Tinder und Co. loggte man sich noch in anonyme Chatrooms ein, um Leute kennenzulernen – zu Hause am elterlichen Desktop-Computer), ebenso wie der Sprachaufenthalt in Australien oder in den USA. «Been there, done that» wurde zu einem Slogan, mit dem wir lakonisch ausdrücken konnten, welche Erdteile wir schon bereist und was wir dort alles erlebt hatten.
«Wann immer von der angeblich schlechten Arbeitsmoral der Generation Z die Rede ist, sind die Millennials die ersten, die die Nase rümpfen. Die wahren Boomer – das sind wir.»
In unseren Zwanzigern gingen wir dann zu «work hard, play hard» über, womit wir unserem toxischen Verhältnis zur Arbeit einen cooleren Anstrich zu verpassen glaubten. Bei einer meiner früheren Arbeitsstellen war Teilzeit verboten, insbesondere Männer mussten es gar nicht erst versuchen. Überstunden aufzuschreiben galt (und gilt teilweise noch immer) in Berufen, die viele aus der Generation Y angezogen haben – etwa der Journalismus oder die Werbeindustrie –, als verpönt. Haben wir dagegen protestiert? Nein. Wir haben uns weggeduckt. Work hard, play hard.
Unser Verhältnis zum Job ist bis heute ungesund geblieben. Unter meinen gleichaltrigen Bekannten gibt es welche, die Startups gegründet haben und darüber krank geworden sind. Männer, die morgens um 7 Uhr das Haus verlassen und nie vor 20 Uhr zurückkommen, obwohl sie kleine Kinder haben. Und Frauen, die neben der Care-Arbeit für Kinder und andere Angehörige noch durchaus stattliche Pensen in bezahlten Berufen stemmen – zum Teil bis zur totalen Erschöpfung.
Natürlich spielen hier geschlechtsspezifische Erwartungen, fehlende Infrastruktur für Familien und ein veraltetes Mutterbild hinein. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass der Job für einen Millennial nicht nur Broterwerb ist, sondern zugleich Identifikation ermöglicht. Erfüllt uns unser Beruf, rackern wir uns bereitwillig dafür ab. Tut er das nicht, sind wir frustriert. Während für einen in den Nachkriegsjahren geborenen Babyboomer ein Job eben vielleicht nur das ist: ein Job.
Eine Studie der Universität Konstanz für die Schweiz scheint genau das zu bestätigen. Demnach legen Millennials zwar etwas mehr Wert auf eine gute Work-Life-Balance als die früheren Generationen. Im hypothetischen Fall, dass wir im Lotto gewinnen und daher kein Einkommen mehr benötigen würden, wären wir aber auch bereit, deutlich mehr zu arbeiten als etwa die Babyboomer – nämlich 18,9 Stunden pro Woche im Vergleich zu 15,7 Stunden. Zudem sind wir im Schnitt unzufriedener mit unseren Jobs und denken öfter über eine Kündigung nach.

Ich erinnere mich an zahlreiche Diskussionen mit Gleichaltrigen, wo ich komisch angeschaut wurde, wenn ich sagte, dass ich auch ohne Kinder kein Job-Pensum von 100 Prozent mehr annehmen würde. Oder dass ich es gut finde, wenn die Jungen höhere Anforderungen an ihre Arbeitgeber stellen, als wir das getan haben. Wenn sie ihre mentale Gesundheit, ihr Sozialleben oder ihr aktivistisches Engagement höher gewichten als ihren Broterwerb.
Doch wann immer von der angeblich schlechten Arbeitsmoral der Generation Z die Rede ist, sind die Millennials die ersten, die die Nase rümpfen. Wo kommen wir denn da hin, wenn alle nur noch Teilzeit arbeiten, und überhaupt, wir mussten uns ebenfalls durchboxen und haben es auch überlebt. Solche Sätze habe ich zuhauf gehört. Nicht von meinen Eltern oder ihren Freunden. Sondern von Gleichaltrigen. Die wahren Boomer – das sind wir.
Keine Lust auf Revolution
Wenn ich auf meine Generation im Jahr 2024 blicke, kommt mir das Lied «Warum syt dir so truurig» von Mani Matter in den Sinn. Es ist eines seiner weniger bekannten Stücke und wurde später als Titel für eine Dokumentation verwendet. Etwas an diesem Liedtext rührt mich auf seltsame Weise an:
Warum syt dir so truurig?
Wohl, me gseht nech’s doch a
Söttet emal öiji Gsichter
Gseh, wenn der sitzet im Büro
Söttet emal öiji Gsichter
Gseh, wenn der fahret im Tram
Warum syt dir so truurig?
S’geit doch so wi der’s weit
Frou u Chind sy doch zwäg, im
Pruef geit’s geng e chly vorwärts
S’längt doch ou hie und da
Scho für nes chlys Drübery
Warum syt dir so truurig?
Nei, dir wüsset ke Grund
Vilicht, wenn der e Grund hättet
Wäret der weniger truurig
Mänge, wenn ds Läben ihm wehtuet
Bsinnt sech derdür wider dra
Mänge, wenn ds Läben ihm wehtuet
Bsinnt sech derdür wider dra
Matter muss gänzlich andere Menschen im Kopf gehabt haben als uns Millennials, als er diese Zeilen schrieb; schliesslich waren wir damals noch gar nicht geboren. Doch ich erkenne uns in dem Text wieder: wie wir nach einem langen Bürotag abgestumpft im ÖV sitzen und durch Instagram scrollen. Wie wir in den letzten Jahren von einer diffusen Schwermut ergriffen wurden, weil die Welt plötzlich nicht mehr so rosig aussieht, wie wir uns das lange Zeit gewohnt waren. Und wie wir doch nicht recht Lust haben auf die grosse Veränderung, die Revolution, sondern allenfalls das kleine «Drübery».
In meiner Wahrnehmung beschreibt Matter in diesem Lied einen gänzlich apolitischen Menschenschlag, der nicht erkennt, wie gut es ihm eigentlich geht. Träge und gleichgültige graue Männer (und Frauen), die erst wieder zur Besinnung kommen, wenn das Leben ihnen übel mitspielt.
Natürlich, solche Menschen hat es schon immer gegeben, das zeigt alleine schon die Tatsache, dass das Lied ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Doch angesichts der Startbedingungen, die meine Generation hatte, angesichts der technischen Möglichkeiten und des schieren Reichtums in diesem Land, frage ich mich, warum wir es nicht geschafft haben, ein anderer Schlag Mensch zu werden. Ein Schlag Mensch, der politischer ist, besser informiert und vor allem aktiver.

Klima, Kreuz und Karton
Nicht Technologien, sondern moralische Werte werden das Klima ...
Damit hier keine Missverständnisse entstehen: Ich bin der festen Überzeugung, dass Probleme wie der Klimawandel oder demokratiefeindliche Strömungen nicht gelöst werden, indem wir alle Verantwortung auf das Individuum abschieben. Es soll eben gerade nicht bloss darum gehen, sein eigenes Gemüse zu ziehen, um seine Ökobilanz zu verbessern, oder selber Hühner zu halten, um nicht eine Industrie zu unterstützen, die das Tierwohl missachtet.
So löblich diese Tätigkeiten sind: Wir müssen darüber hinausgehen. Wir müssen unsere private Selbstumkreisung aufgeben und anfangen, zu politischen Lösungen beizutragen. Rosen pflanzen, nicht nur um uns daran zu erfreuen, sondern weil wir ein besseres Morgen gestalten wollen.
Gegen die Trägheit
Mit einer Freundin habe ich mich kürzlich genau darüber unterhalten. Erstaunlich viele ihrer Bekannten würden sich kaum für die Welt interessieren, sagte sie, und ob diese vielleicht das bessere – weil unbekümmertere – Leben führen würden als wir. Ich widersprach, doch so richtig gute Argumente fielen mir in dem Moment nicht ein.
Wenig später sah ich einen Post der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer, wonach die Zustimmung zur rechtsradikalen AfD seit den massiven Strassenprotesten der letzten Wochen gesunken sei. «Aktivismus wirkt und Einsatz lohnt sich», schrieb Neubauer. Ich schickte einen Screenshot des Beitrages an meine Freundin.
«Vielleicht liegt in den kleinen Schritten eine Chance: dafür, möglichst viele Menschen auf den Weg mitzunehmen.»
Am selben Abend klingelte es an der Tür: ein Student, der um eine Mitgliedschaft beim Roten Kreuz warb. Noch vor kurzem hätte ich ihn schnell abgewimmelt, genau wie ich es mit den jungen Männern und Frauen tue, die mir mit ihren Unterschriftenbögen auf dem Weg zum Zug auflauern. Dieses Mal unterschrieb ich.
Zugegeben, das sind kleine Schritte – auch ich habe noch viel Trägheit in mir, die ich zuerst abschütteln muss. Aber vielleicht liegt in diesen kleinen Schritten eine Chance: dafür, möglichst viele Menschen auf den Weg mitzunehmen. Mit jedem Post, den wir teilen, und jeder kritischen Diskussion, die wir führen.
Nicht jeder mag sich gleich an ein Atomkraftwerk ketten; Geld spenden für den Schutz des Regenwaldes oder für Nothilfe in Krisengebieten, das könnten jedoch die meisten von uns. Wir könnten auch wütende Leserbriefe schreiben oder Flyer verteilen für eine Initiative, die wir gut finden. Bezahlte Arbeit nicht mehr über alles stellen, damit andere Formen von Engagement überhaupt erst möglich werden. Oder auf Social Media einen Raum öffnen für wenig diskutierte Themen oder gar Missstände. Selbst die von mir gescholtenen Influencerinnen hätten da gewisse Möglichkeiten. Und so könnte ich auf Instagram auch wieder Adventskränze anschauen, ohne danach das Bedürfnis zu spüren, mir sämtliche Haare einzeln auszureissen.