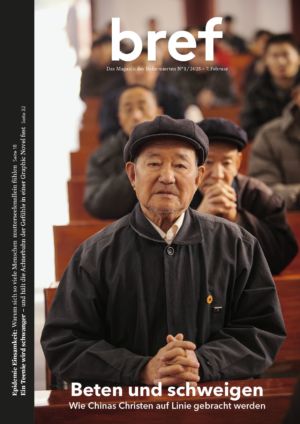Kosmischer Staub
Vieles im Leben ist unfreiwillig. Schwimmen beispielsweise. Ich habe vor zwei Wochen damit angefangen, nachdem ich erfahren hatte, dass energiegeladenes Herumsitzen nicht als sportliche Betätigung gewertet werden kann.
In meinem Alter fangen viele Männer mit Joggen an, aber das kommt für mich nicht in Frage, da ich dabei von zu vielen Hunden verfolgt werde. Schwimmen hat den Vorteil, dass man dabei in der Regel keinen Hunden begegnet – und falls doch, sollte man dringend das Hallenbad wechseln. Der Nachteil besteht natürlich darin, dass man sich dafür umziehen muss. Ich hasse das.
Ich mag keine Übergänge, schon gar nicht, wenn dabei eine Badehose mit im Spiel ist. Allein in der verschlossenen Kabine weiss ich nie, welchen Körperteil ich bedecken soll.
Wie lächerlich, dachte ich, als ich mich das letzte Mal bei meinem Slapstick-Striptease ertappte. Glaubst du wirklich, es interessiere sich irgendjemand innerhalb oder ausserhalb dieser ernüchternd farblosen Kabine für dein welkes Fleisch? Woher kommt dieser manische Glaube, der absolut wichtigste Mensch auf diesem Planeten zu sein?
Meine Gedanken glitten zu einer Ausgabe der «NZZ», bei deren Lektüre mich immer so ein Vergeblichkeitsgefühl beschleicht, wie ich es sonst nur vom Ausfüllen meiner Steuererklärung kenne. In gleich zwei Interviews wurde in dieser Ausgabe ein neuer Individualismus als heilsbringende Kraft propagiert.
In einem besonnenen Gespräch plädierte der Historiker Andreas Rödder dafür, das Individuum wieder ins Zentrum zu stellen. Qualifikation und freier Wille sollen wichtiger werden als Klasse und Herkunft.
Etwas weniger besonnen äusserte sich im zweiten Interview der «Welt»-Herausgeber Ulf Poschardt, der sich am liebsten gleich von sämtlichen gesellschaftspolitischen Fortschritten der letzten Jahre in Sachen Gleichberechtigung, Inklusion und Diversität verabschieden möchte und von einer Welt träumt, durch die ein rauerer Wind pfeift: «Mehr Gotham City, weniger Bullerbü.»
Erst war ich verwirrt. Ich hatte geglaubt, es brauche wieder mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und politische Partizipation. Und nun las ich, dass sich diese Herren für mehr Einzelgänge aussprechen. Dann aber dachte ich darüber nach und auf einmal machte alles Sinn.
Wir alle waren in den vergangenen Jahren auf der Suche nach uns selbst, angeleitet von Yoga-Meistern und Ratgeberautoren, die uns weismachen wollten, dass das grösste Glück auf Erden in der Selbsterfüllung läge. Wir sind diesen Weg gegangen und dabei eines Tages auf ein ärgerliches Hindernis gestossen: andere Menschen.
Es zeigte sich, dass schrankenlose Selbsterfüllung nicht möglich war, solange es da noch einen gab, der etwas dagegen hatte, wenn man nachts um zwei die Brandenburgischen Konzerte in Originallautstärke laufen liess oder auf Facebook seine Meinung sagte. Und es leuchtet vollkommen ein, dass in uns das Bedürfnis erwachte, diesen einen aus dem Weg zu räumen.
Erst geschah dies, indem das moralisierende Gegenüber als Gutmensch und später mit dem etwas hipperen Begriff der Wokeness diffamiert wurde. Und nun sollen also endlich auch politische Konsequenzen folgen.
Man braucht sich nur die Reden von Leuten wie Trump oder Milei anzuhören, um zu ahnen, was das bedeuten könnte. Und vielleicht reicht es auch einfach, das «NZZ»-Foto von Ulf Poschardt zu betrachten, der vor seinem schwarzen Ferrari posiert und dabei aussieht, als träume er noch immer von Batman. Ein rauer Wind. Ein lächerlicher Wind. Und wofür? Damit endlich Ruhe ist.
Mein Slapstick-Striptease war abgeschlossen. Da hörte ich draussen die Stimmen zweier älterer Männer, die ihre Nachmittage im Hallenbad zu verbringen scheinen. Sie sitzen halbnackt in der öffentlichen Garderobe und plaudern. Ins Wasser scheinen sie nicht zu gehen. «Wir sind Staub», hörte ich den einen sagen. «Kosmischer Staub. Wenn sie dich nicht mögen, wenn sie nicht mögen, was du tust, dann scheiss auf sie.»
Diese Jungs haben es begriffen.