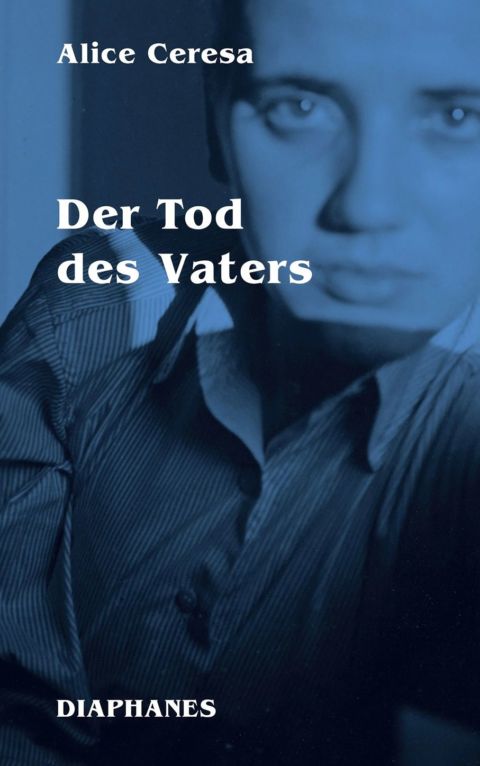
«Der Tod des Vaters» von Alice Ceresa
Ein Patriarch stirbt und die Mitglieder seiner Familie versammeln sich zur Beerdigung. Da ist die Mutter, der ihr Ehemann schon lange fremd geworden ist. Da sind die beiden Töchter und der Sohn. Die älteste, die stets unter der Gleichgültigkeit ihres Vaters gelitten hat, sieht sich nun berufen, die Rolle als Familienoberhaupt einzunehmen. Ihre jüngere Schwester hat sich auf eine Art innere Reise begeben. Und der Sohn, der inzwischen selbst Vater geworden ist, vollendet mit der Beerdigung einen Prozess der Abnabelung.
Das ist die Ausgangslage der kurzen Erzählung «Der Tod des Vaters» von Alice Ceresa – und gleichzeitig ihre gesamte Handlung. Doch was so schnörkellos klingt, müssen sich die Leserinnen hart erkämpfen.
Das hat verschiedene Gründe: So haben die Figuren keine Namen, sprechen nie direkt miteinander und machen überhaupt nur selten mehr als träumen, rauchen oder mit dem Hund spazieren gehen. Hinzu kommt die Erzählstimme, die eigentümlich distanziert als «wir» über den Familienmitgliedern zu schweben scheint, was die Identifikation mit ihnen zusätzlich erschwert, verhindert, dass man ihnen wirklich nahekommt.
Beseelt scheinen dagegen die Gegenstände im Haus der Familie. Die Fotografien des Vaters, die sich im Moment seines Todes ebenfalls aufzulösen beginnen. Oder die Kleider, die ihre Fähigkeit verlieren, sich an den Körper des Verstorbenen zu schmiegen. Das ist zwar einerseits poetisch, fast schon magisch; andererseits hilft es einem beim Lesen nicht, bei der Geschichte zu bleiben.
Und nicht immer stimmen die Bilder, die Ceresa wählt: «Über diese patriarchale Familie brach der Tod des Vaters herein wie eine ferne Vergletscherung, irgendwo in den nunmehr verlassenen Gefilden, in denen die Familienmitglieder noch immer feierlich die Gesten ihres längst vergangenen gemeinsamen Lebens wiederholen.» Man muss den ersten Satz des Buches dreimal lesen, um eine Ahnung zu bekommen, was gemeint sein könnte.
Trotz diesen Hürden entwickelt «Der Tod des Vaters» einen Sog. Er ist im Subtext der Erzählung begründet: Nichts ist gut zwischen diesen Protagonistinnen, und mit Sätzen wie Nadelstiche lässt Ceresa ihre Leserinnen das erkennen.
«Eine kurze Unruhe zieht auf, die sich aber schnell legt, sodass sich alle wieder sich selbst zuwenden», heisst es etwa, als die Trauergemeinde in der Kirche sitzt. Oder dann: «Diese Familie ist kein Freund von Friedhöfen und beobachtet hier und da betroffen das offen zur Schau getragene Mitgefühl, das andere anderen Toten entgegenbringen.»
«In Ceresas Text ist die Hölle der bürgerlich-patriarchalen Familie eiskalt», bringt es die Übersetzerin Marie Glassl in ihrem Nachwort auf den Punkt. Doch anstatt den Todesfall als Chance für einen Neuanfang zu nutzen, erhalten die Familienmitglieder die einstudierten Muster aufrecht. «Der reale Vater muss nicht überleben, um die von ihm repräsentierte patriarchale Idee zu bewahren», schreibt Glassl dazu.
Mit ihrer experimentellen Literatur übte Ceresa Kritik an verkrusteten sozialen Strukturen und der traditionellen Familie. Geboren 1923, wuchs sie in Basel und Bellinzona auf und zog 1950 nach Rom, wo sie unter anderem als Autorin, Übersetzerin und Redaktorin arbeitete. Sie hatte Kontakt zur italienischen Avantgarde und zur feministischen Bewegung, setzte sich mit Begriffen wie Weiblichkeit, Vaterland oder Herkunft auseinander.
Allerdings publizierte sie kaum – obwohl ihr erster Roman, «La figlia prodiga», (dt. «Die verlorene Tochter», 1967) ihr viel Lob und einen renommierten Literaturpreis einbrachte. «La morte del padre» erschien erst zwölf Jahre später in einer Zeitschrift und 2003, zwei Jahre nach Ceresas Tod, in Buchform. Nun ermöglicht es die deutsche Übersetzung, diese in Vergessenheit geratene Autorin neu zu entdecken – und die ungewöhnliche Art, wie sie die Welt betrachtet hat.
Alice Ceresa: «Der Tod des Vaters». Diaphanes, Zürich/Berlin 2024; herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Marie Glassl; 80 Seiten; 27.90 Franken.



