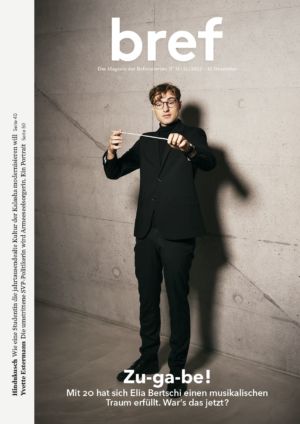Wer nach einer Metapher für alles Triste der Moderne sucht, der wird beim Beton fündig. Massive, graue Bauten sind der in Form gegossene Gegenentwurf zu leichtfüssiger Lebensfreude. Auch hat sich das Zementgemisch als Erzfeind unberührter Landschaften etabliert. Weil die Herstellung von Zement für ganze acht Prozent der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich ist, gilt Beton zudem als Klimakiller. Beton steht für grau statt grün – «zubetoniert» eben.
Trotzdem: Kein Rohstoff wird weltweit häufiger verwendet, von Wasser einmal abgesehen. In der Schweiz sei die rohe, unverputzte Form besonders beliebt, sagt Karin Bürki. Die Autorin und Fotografin ist Expertin auf dem Gebiet des Brutalismus – so nennt sich die architektonische Stilrichtung des massiven Einsatzes von Sichtbeton im Bauwesen.
«Beton ist ein Schweizer Kulturgut. Er überzieht das Land wie eine Tapete», sagt Bürki, die mit dem Label Heartbrut Entdeckerkarten zu besonders gelungenen Brutalismusbauwerken in der Schweiz produziert. «Schule, Bahnhof, Wohnhäuser, Kirche: Sichtbeton ist hier selbst im hintersten Bergdorf so allgegenwärtig, dass wir ihn oft gar nicht mehr wahrnehmen.»

Seelenloser Betonklotz oder Meisterwerk der Architektur? Wie bei vielen im Brutalismusstil geschaffenen Bauwerken gehen auch bei der katholischen Kirche Lommiswil SO die Meinungen auseinander.
Zahlreiche Neubauten in der Nachkriegszeit wurden mit dem Gemisch aus Zement, Wasser und Sand gebaut. Die Zeit zwischen den 1960er und 1980er Jahren gilt als Blütezeit des Brutalismus, als das Zur-Schau-Stellen von möglichst grob angeordnetem Sichtbeton en vogue war.
Wo Beton besonders kräftig angemischt wurde, waren die Kritiker allerdings nie weit, denn polarisiert haben brutalistische Bauwerke schon immer. Nicht zuletzt Kirchgemeinden, die auf den Zug aufsprangen, sahen sich lautstarken Protesten ausgesetzt – wohl darum, weil für Sakralbauten besondere Massstäbe gelten.

Die Martin-Luther-Kirche in der Stadt Zürich wurde auf einem kleinen Spickel Land gebaut. Einen «Schandfleck» nannten Anwohner den Betonbau einst. Heute steht er unter Denkmalschutz.
So wurde etwa die reformierte Kirche in Effretikon ZH unmittelbar nach ihrer Einweihung als «Giraffentränke» und «Seelenabschussrampe» geschmäht. Sie wurde nur darum nicht wieder abgerissen, weil der Architekt der Kirchgemeinde mit rechtlichen Schritten drohte. Die Martin-Luther-Kirche in der Stadt Zürich wiederum wurde als «Schandfleck» und «Reissbrett-Fingerübung für Bauaufgaben auf dem Mond» bezeichnet. Heute stehen beide Kirchen unter Denkmalschutz und erfüllen manchen Anwohner mit Stolz.
Architektonische Meisterwerke
Auch anderswo in der Schweiz stehen Kirchen mit massenhaft verbautem Beton. Einige davon gelten als wahre architektonische Meisterwerke: so zum Beispiel die römisch-katholische Kirche Saint-Nicolas in Hérémence VS. Bürki nennt die Konstruktion des Architekten Walter Maria Förderer das «Matterhorn des Schweizer Brutalismus». Eingebettet in ein Dorf aus lauter Chalets prägt der massive Betonbau als höchstes Gebäude weit und breit das Ortsbild.
Aber auch von innen ist das fensterlose Gebäude, in das einzig Licht von oben dringt, ein Hingucker, ob man es nun bewundert oder verachtet. Der sechseckige Saal, der sage und schreibe 1000 Menschen Platz bietet (Hérémence hat 1500 Einwohner), wirkt wie eine aus dem Fels gehauene Höhle mit zahlreichen Öffnungen, Ecken und Kanten. Im Gebäude befinden sich auch ein Supermarkt und ein Café; der Kirchturm beherbergt eine Bibliothek, und von dessen Flachdach sieht man auf die Walliser Alpen.
Auch die 1971 gebaute und damit erste ökumenische Kirche der Schweiz in Langendorf SO gilt als leuchtendes Beispiel des Brutalismus. Sie besteht aus zwei Betonkirchen unmittelbar nebeneinander. Den Turm, den Vorplatz sowie den Keller teilen sich Reformierte und Katholiken. Teile des Kirchenzentrums erinnern an eine Skulptur oder ein Parkhaus.
Dass Beton für sakrale Architektur benutzt wird, ist kein Phänomen der Neuzeit. Gemäss neueren Studien sollen bereits die Ägypter beim Bau von Pyramiden vor 5000 Jahren auf eine Art antiken Beton zurückgegriffen haben. Dieser wurde möglicherweise mit Kalk und Bindemitteln gegossen.
Während sich Archäologen diesbezüglich noch streiten, ist gesichert, dass die Römer vor rund 2000 Jahren zahlreiche Bauten mit einer Mischung aus Sand, Wasser, gebranntem Kalk und Steinbrocken fertigten. Sie verstanden es gar, einen langlebigeren Beton zu mischen als jenen, der heute verwendet wird. Das zeigt sich daran, dass viele Bauwerke wie etwa das Pantheon in Rom auch nach sehr langer Zeit noch beinahe unversehrt sind, während manche modernen Bauwerke mit schlecht verarbeitetem Beton bereits nach wenigen Jahrzehnten baufällig werden.

Die römisch-katholische Kirche Saint-Nicolas in Hérémence VS gilt als das «Matterhorn des Schweizer Brutalismus».

Der Innenraum von Saint-Nicolas: Das Gebäude wirkt wie eine aus dem Fels gehauene Höhle.
Im Mittelalter ging das Wissen um die Betonherstellung verloren. Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde er wieder als Baustoff eingesetzt. Doch zunächst wurde lange Zeit versucht, den rohen, als unschön empfundenen Beton möglichst zu verbergen – bis nach dem Zweiten Weltkrieg der Brutalismus aufkam und das Zementgemisch zum Baumaterial der Stunde machte. Als Stilbegründer gilt der genauso bekannte wie umstrittene Architekt Le Corbusier. «Es herrschte Aufbruchstimmung und Zukunftsoptimismus», sagt Karin Bürki über die Architektur der 1960er und 1970er Jahre. Schliesslich mussten in Europa auch die Brachen der vom Krieg gebeutelten Städte gefüllt werden.
Am Anfang stand ein sozialer Gedanke
Schaut man sich die heutigen Brutalismusbauwerke an, dann haftet manchen etwas Grössenwahnsinniges, Autoritäres an. Bürki sagt: «Man vergisst oft, dass hinter der harten Schale ein sozialer Kern steckt.» Denn das schnelle, effiziente und kostengünstige Bauen habe es damals gesellschaftlich schlechter gestellten Menschen ermöglicht, modern zu wohnen.
In Verruf geriet der Betonprunk in den 1980er Jahren. Einerseits wegen der aufkeimenden Umweltbewegung, andererseits wurden die teilweise sehr billig hergestellten Plattenbauten mit dem Sozialismus assoziiert, der in der westlichen Welt zum Feindbild verkommen war. Mit etwas Abstand feiern Brutalismus-werke derzeit eine Art Mini-Revival; ausserdem tüfteln Forschende daran, wie Beton umweltfreundlicher produziert und effizient rezykliert werden kann.
Dass aber je wieder Kirchen wie jene im Walliser Bergdorf Hérémence gebaut werden, ist undenkbar. Alleine schon wegen der zunehmenden Anzahl an Bauvorschriften, die ein allzu innovatives Bauen verhindern. «Die Zeit, als Architekten bestimmen konnten wie Gott, ist definitiv vorbei», sagt Bürki.
Das heisst aber nicht, dass die Schweizer Abstand nehmen vom Betonbau, im Gegenteil. Während gegen aussen das Bild einer Chaletschweiz gepflegt wird, wird kräftig Zement angemischt: Insgesamt 16 Millionen Kubikmeter Beton werden jedes Jahr in der Schweiz verbaut – gegenüber vergleichsweise bloss 1 Million Kubikmeter Holz.
Warum gerade die Schweiz wenig Berührungsängste hat mit Sichtbeton, dafür sieht Bürki zwei Gründe. Einer ist eine Art typische Schweizer Bodenständigkeit. «Das Rohe, Ehrliche, Ungeschönte kommt in der Schweiz gut an.» Das Wort Brutalismus stammt denn auch nicht vom Wort «brutal» ab, sondern vom französischen «brut», das so viel bedeutet wie «roh, unbearbeitet». Der zweite Grund ist laut Bürki Pragmatismus. Denn Beton ist kostengünstig und im Vergleich zu anderen Materialien stabil. Er gilt als Baustoff für die Ewigkeit – was so gesehen gut passt für den Bau von Kirchen.
Titelbild: Die 1971 gebaute und damit erste ökumenische Kirche der Schweiz in Langendorf SO besteht aus zwei Betonkirchen. Manche Teile des Kirchenzentrums erinnern an eine Skulptur, andere an ein Parkhaus.