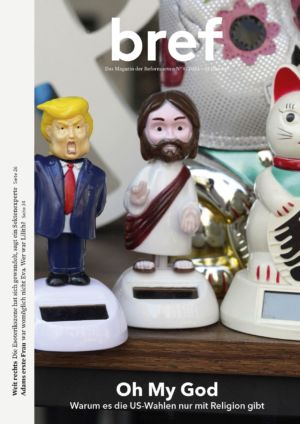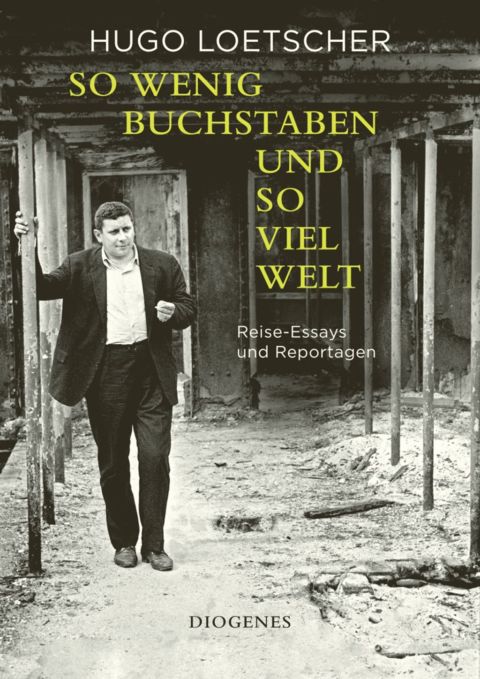
«So wenig Buchstaben und so viel Welt» von Hugo Loetscher
Es ist ein bisschen wie bei Stan Wawrinka und Roger Federer. Neben seinen bekannten Zeitgenossen wie Frisch oder Dürrenmatt geht der Zürcher Schriftsteller Hugo Loetscher häufig vergessen. Vielleicht, weil es von ihm nicht das eine bekannte Werk gibt, das an Gymnasien gelesen wird. Vielleicht, weil ihm der grosse internationale Erfolg verwehrt blieb. Vielleicht auch, weil seine Texte nicht einfach einzuordnen sind. Zu Leb- und Arbeitszeiten war Loetscher seiner Zeit voraus. Aus heutiger Sicht erscheinen seine Texte gleichwohl offensichtlich zeitbedingt.
Diese Spannung allein macht den unlängst im Zürcher Diogenes-Verlag erschienenen und sorgfältig kuratierten Band mit 35 seiner mehreren Hundert Texte lesenswert.
Beginnen wir mit den Umständen: Loetscher genoss als Kind einer Handwerkerfamilie in Zürich Aussersihl eine humanistische Ausbildung mit Studium in Zürich und Paris bis zur Dissertation. Bereits in den 1950er-Jahren schrieb er erste Reisereportagen und wurde von Zeitschriften in die Welt hinaus geschickt, als Langstreckenflüge noch nicht zum jährlichen Ritual der Schweizer Mittelklasse gehörten.
So erarbeitete er sich einen eigenen Blick auf die sich globalisierende Welt während der goldenen Zeit des Schweizer Magazinjournalismus. Loetschers Essays, Kritiken und Reportagen waren gefragt und erschienen regelmässig im Kulturmagazin «Du», in der «Weltwoche» oder im «Magazin» des «Tages-Anzeigers». Und neben den Heften hatten auch die Feuilletons der Tageszeitungen Raum, Zeit, Geld und den Mut, der Leserschaft die neuen Welten zuzumuten, die der Schriftsteller in die Schweizer Wohnzimmer brachte.
Loetscher war kein bissiger Kritiker, dennoch zeigen seine Texte ein feines Gespür für Ungerechtigkeiten. Er führte eine Art Postkolonialismusdebatte avant la lettre und zeigte ein profundes Interesse für historische Entwicklungen, kulturelle Nuancen und ganz besonders alles andere. Die Vermittlung dieser Themen war auch zu Loetschers Zeit eine Herausforderung. Der Schriftsteller weiss bald: «Nicht das Vermitteln und das Vermittelte sind das Problem, sondern ob wir lernen, mit Informationen umzugehen – das gilt für den, der sie gibt, und so gut für den, der sie zur Kenntnis nimmt.»
In seinen Texten geht diese Kenntnisnahme selten reibungslos vonstatten. Denn Loetschers Informationen sind ersehen, erlebt, erlesen und nicht so sehr erfühlt. In seinen Texten berichtet er eher von untersuchten Bauwerken, vergessenen Statuen und gelesenen Büchern als von Gesprächen mit Menschen. Herausfordernd ist auch sein offener, nicht selten ausfransender Stil; rundes Storytelling sucht man vergebens. Manchmal wirkt sein Gedankengang sprunghaft, unpräzise, doch dann ist da plötzlich ein knackiger Satz.
Loetscher suchte stets Vielfalt und Offenheit und fand sie nicht selten in Lücken und Widersprüchen. Er suchte das, was weiterhin möglich sein kann, weil es einmal möglich war. Städte faszinierten ihn wegen der Vermischung von Lebensweisen, Kulturen und Ethnien als «grösstmögliche Gleichzeitigkeit menschlicher Möglichkeiten».
Portugal zog ihn an, weil das Land kein Kapital aus seinen vielen Kolonien, all dem vergossenen Blut, schlagen konnte. Wären die Entdecker etwa besser zu Hause geblieben? Aus Russland berichtete er 2002 über die Feier der Unabhängigkeit von der Sowjetunion und fragte: «Ist das nicht fast schon so etwas wie unabhängig von sich selber?»
Diese Frage hätte ihn auch in Bezug auf seine eigene Identität interessiert, die er stets als Spannungsfeld erlebte. Derartige Spannungen – er bezog sich dabei auf seine Herkunft und mied es, seine sexuelle Orientierung zu thematisieren – gelte es keinesfalls zu neutralisieren. Seine Lösung sei es vielmehr gewesen, schrieb er in seinem letzten Essay, sie zu «fruktifizieren». Wer das Buch gelesen hat, wird Loetscher und seine Zeiten besonders heute vermissen.
Hugo Loetscher: «So wenig Buchstaben und so viel Welt. Reise-Essays und Reportagen». Diogenes, Zürich 2024; 480 Seiten; 34.90 Franken.