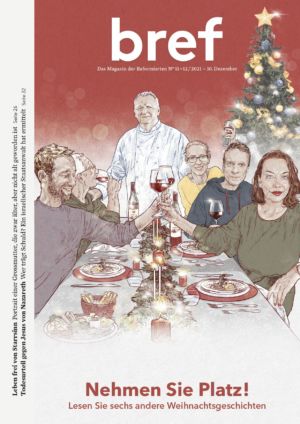Arbeiten, Leben, Sport: Das Wohnzimmer wird zum Corona-Lebensmittelpunkt.
Vor wenigen Tagen ist Ihr zweites Buch zur Pandemie erschienen. Hängt Ihnen Corona nicht zum Hals raus?
Klar, wem nicht. Trotzdem kann und muss man sich Gedanken machen, was da los ist. Es genügt nicht, Tag für Tag Zahlen zu Geimpften und Hospitalisierungsraten zu betrachten und sich für den Booster anzumelden. Man soll in die Welt schauen – selbst wenn wir alle etwas betäubt sind. Ich habe mir gesagt, das erlebst du hoffentlich nur einmal. Die Idee war, das zu verdichten – die Gesellschaft mit ihren Eingeweiden und ihrer Mechanik zu erkennen, zu verstehen, was da wirklich läuft – nicht nur in der Schweiz, sondern europa-, ja weltweit.
In «Sauerstoff» schildern Sie täglich in kurzen Notizen Ihren Alltag, Sie kommentieren aber auch Weltpolitik.
Tatsächlich nehme ich beim Blick auf diese Zeit verschiedene Perspektiven ein. Ich wohne in Bern und nehme auf, was ich hier erlebe. Komme ich nach Hause, verfolge ich internationale Nachrichten und versuche, diese einzuordnen. Mein Buch ist kein Journal intime, sondern der Bericht eines Journalisten, als den ich mich durchaus noch immer verstehe. Ich schreibe über Beobachtungen, die ich bei Kindern mache, aber auch über globale Erkenntnisse, blicke sozusagen von Bern bis Peking. Entstanden sind kleine Essays, Miniportraits, in einem Wort: Kalendergeschichten. Ich sehe mich insofern auch als Chronisten und möchte sagen, in dieser Zeit ist etwas Drängendes. Das Journal zu führen war auch anstrengend.
Weshalb?
Corona ist eine Zäsur. Selbst wenn es morgen verschwindet, prägt es uns noch lange. Bereits nach einer Woche war für mich klar, ich muss jeden Tag etwas schreiben, selbst wenn es nur ein Satz ist. Schreiben ist immer anstrengend, das geht auch mir als Profi nicht so leicht von der Hand.
«Tiefer über etwas nachzudenken kann besser trösten als süssliche Worte.» Samuel Geiser
Trägt zu diesem Empfinden auch das Thema bei?
Nein, das habe ich nicht so empfunden. Im Gegenteil. Ich konnte einer gewissen Machtlosigkeit etwas entgegensetzen. Die ganze Chose ist sehr trist. Die Trychler waren sehr präsent in Bern – ihr Klang hat die Stadt akustisch besetzt.
Da sehe ich meine Aufgabe als Widerstand, den ich markieren kann, und die Analyse als eine Gegenwehr. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass das Buch jenen, die es in die Hand nehmen, Kraft vermittelt. Tiefer über etwas nachzudenken kann besser trösten als süssliche Worte.

Alles zu: Picknick im Corona-Winter.
Die Pandemie hält an. Erkennen Sie darin positive Aspekte?
Die Situation ist zum jetzigen Zeitpunkt derart prekär, dass ich allein dieses Wort «positiv» als gefährliche Formulierung empfinde. Krankheit als etwas Gutes zu betrachten, das ist gefährlich. Die Zeit zwingt uns, mehr nachzudenken: über die Gesellschaft, das Leben, politische Entwicklungen. Positiv ist es erst, wenn es etwas Positives bewirkt. Etwas Gutes draus machen, zum Beispiel Carearbeit aufwerten, das wäre eine positive Auswirkung.
Sie haben lange Jahre als Redaktor für die Mitgliederzeitschrift der reformierten Berner Landeskirchen gearbeitet. Wie erleben Sie die Kirchen während Corona?
Zu meinen nächsten Nachbarn zählt der Architekt Marco Ryter, ein kreativer, leidenschaftlicher Mensch. Er ist Kirchgemeindepräsident der Johanneskirche in Bern. Durch ihn habe ich sehr direkt miterlebt, wie Kirchen mit der Pandemie umgegangen sind. Er sagte, gerade jetzt brauche es die Kirchen. Ryter hat sich dafür eingesetzt und dazu beigetragen, dass die Johanneskirche offen geblieben ist. Einmal hat die Organistin gespielt, alle Fenster und Türen waren offen, das Quartier wurde beschallt. Super, was die Kirche da geleistet hat. Gleichzeitig kritisiere ich sie auch.

Einblick in den Kampf ums Leben, Intensivstation Inselspital Bern 2021.
Weshalb?
Die Autorin und Musikerin Melinda Nadj Abonji hat im Dezember 2020 den «Aufruf gegen die Gleichgültigkeit» initiiert. Darin ging es darum, auf die vielen Corona-Toten, die wir in der Schweiz hatten, aufmerksam zu machen und eine verantwortungsvolle Politik zu fordern. Für mich war es sehr ernüchternd, ja gar katastrophal, dass die Kirchen als Institution diesen Aufruf nicht unterstützt haben. Sie haben sich entschieden, staatstreu zu bleiben. Ich hätte etwas anderes erwartet.

Samuel Geiser
Samuel Geiser ist in Bern aufgewachsen. Er studierte Geschichte und Germanistik in Bern und Berlin und war bis 2015 Redaktor bei der Berner Ausgabe von «reformiert.». Geiser ist Autor mehrerer Bücher, als Co-Autor hat er «Revolte, Rausch und Razzien – Neunzehn 68er blicken zurück» mitverfasst. «Sauerstoff» ist nach «Fieber» sein zweites Corona-Journal. Geiser ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in der Stadt Bern.
Corona hat Sie persönlich betroffen. Ihre Frau und Sie sind daran erkrankt. Wie sind Sie damit umgegangen?
Meine Frau erkrankte zuerst. Dann wurde auch ich positiv getestet. Das war insofern eine Erleichterung, als nun das Setting klar war: Isolation für uns beide. Meine Frau war schwerer krank als ich, und da kam die Angst, was, wenn es schlimmer wird? Wenn sie ins Spital muss? In solchen Momenten kamen die Bilder hoch, wie wir sie aus Bergamo kennen: Särge auf Militärlastwagen.
Heute sind Sie genesen und dreifach geimpft. Waren Sie erleichtert, Corona gehabt zu haben, oder wütend, krank geworden zu sein?
Vor allem war ich meinen Nachbarinnen und Nachbarn sehr dankbar. Alle elf Parteien, die mit uns im Haus wohnen, haben sich bei uns gemeldet – mit Blumen, Kuchen, einer Nachricht. Diese Art von Solidarität ist bis heute bestehen geblieben.
«Die Schliessung öffentlicher Räume, von Museen und Restaurants, war das ärgste.» Samuel Geiser
Welcher Verzicht ist Ihnen am schwersten gefallen?
Die Schliessung öffentlicher Räume, von Museen und Restaurants, war das ärgste – obschon ich nicht übermässig häufig hingehe. Allein die Vorstellung, dass solche Orte nicht besucht werden können, war schlimm.
Das öffentliche Leben einzuschränken, so nötig es war, ist ein enormer Eingriff in die Gesellschaft. Noch stärker empfinden das sicherlich Alleinstehende. Meine Frau und ich hatten wenigstens einander, als wir an die Wohnung gebunden waren.
Sie haben sich viele Monate lang mit der Pandemie befasst. Was hat sich verändert?
Letztes Jahr gab es eine Art Euphorie, grosse Themen anzupacken – etwa über ein starkes öffentliches, nicht gewinnorientiertes Gesundheitswesen nachzudenken. Ich hätte gerne grosse Fragen diskutiert. Nun stelle ich fest, dem ist Ernüchterung entgegengetreten. Wir müssen uns mit Fragen befassen wie: Was bewegt die Impfgegner? Wer sind diese Trychler? Das ist fast peinlich, und es ist vor allem traurig, ja beängstigend.
Was soll Ihr Buch verändern?
Es ist eine Erinnerung, auch für mich selbst, Tage, die durchfliessen, aufmerksamer anzugehen. Im Dickicht des Tages Orte zu finden, an denen ich mich rausnehmen kann. Mein Journal soll dazu anregen, das, was in der Welt geschieht, genauer zu betrachten.
Gibt es ein drittes Corona-Journal?
Momentan plane ich das nicht, aber «never say never». Dürfte ich mir etwas wünschen, wäre das eine szenische Inszenierung mit Texten aus «Fieber» und «Sauerstoff».
Samuel Geiser / Alexander Egger (Fotografie): «Sauerstoff. Corona – Was war. Was kommt.» Sinwel, Bern 2021; 246 Seiten; 38.50 Franken.